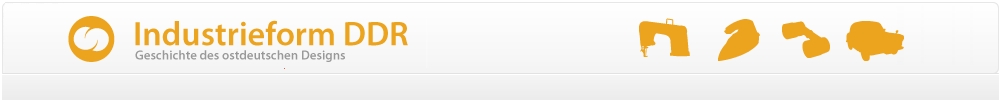Zum Lebenswerk der Gestalterin Margarete Jahny
Liebe Mitglieder und Gäste der Marianne Brandt Gesellschaft Chemnitz,
verehrte Gastgeber hier in der Villa Esche,
seien Sie zunächst bedankt für Ihr Hiersein – und mein besonderer Dank auch an dieser Stelle für die Gelegenheit, Ihnen eine Frau vorstellen beziehungsweise näher bringen zu können, die in beispielhafter Weise steht für eine sehr besondere Generation von ostdeutschen Industrieformgestaltern.
Margarete Jahny, geboren 1923 in Niederschlesien und seit 1945 in der Lausitz, dann in Berlin und schließlich wieder bei Kamenz lebend, gehört zu den ersten Hochschulabsolventen der DDR, die mit einem Produktgestalter-Diplom in der Tasche in die Industrie gingen, um sich hier mit ihrer künstlerischen Begabung und Ausbildung in den Dienst serieller Produktkultur – und damit direkt ja auch in den Dienst am Nutzer zu stellen. Diese Absolventen der Gestaltungsfach- beziehungsweise -hochschulen in Wismar, Weimar und Dresden Anfang der Fünfzigerjahre waren eine kleine, aber recht einflussreiche Gruppe von Design-Pionieren, deren Leistungen nicht hoch genug wertzuschätzen sind. Gewichtiger noch als ihre eigenen realisierten vorbildhaften Entwürfe für industrielle Serienprodukte war nämlich, was sie als Wegbereiter, Vorbilder, Anreger und Lehrer in die Waagschale ostdeutscher Industriekultur legten. Margarete Jahny ist eine dieser oft hinter den Kulissen arbeitenden und dabei ganz hervorragenden Persönlichkeiten.
[paycontent]Bekannt war mir Margarete Jahny seit Ende der Siebzigerjahre, vor allem aus Veröffentlichungen in der Berliner Fachzeitschrift form+zweck, die ich dann von 1984 bis 1989 selbst leiten durfte. Wirklich kennen gelernt haben meine Frau und ich Frau Jahny schließlich 1997, richtiger: seit 1997, denn die Verbindung zwischen dem Ehepaar Höhne und ihr ist längst eine regelmäßige und vertraute geworden. Damals also, vor 13 Jahren, folgte ich der Bitte des Designzentrums Sachsen-Anhalt in Dessau, über die Marianne-Brandt-Schülerin (darauf komme ich noch zurück) eine Monografie zu schreiben, die dann auch wirklich pünktlich zum 75. Geburtstag Margarete Jahnys im Mai 1998 erschien. Es war mein erstes Buch zum Thema Design und nicht nur jener Premiere wegen zudem eines, das mich eine Menge Courage, Beharrlichkeit und zuweilen auch Zweifel an meiner verantwortlichen Eignung als Verfasser dieser Biografie kostete. Nie zuvor war ich Frau Jahny von Angesicht zu Angesicht begegnet, kannte „nur“ ihr Lebenswerk – und sie mich ausschließlich vom Lesen her, als Chefredakteur von form+zweck. Und mit „Chefs“ hatte sie es nie besonders, weder mit ihnen im Nacken noch Auge in Auge.
Entsprechend verhalten ließen sich unsere ersten Begegnungen an, damals noch in ihrer bereits in Auflösung befindlichen Berliner Wohnung in Prenzlauer Berg. Das Mikrofon für die Tonbandaufzeichnungen unserer Gespräche war ihr gar nicht geheuer, von ihren Skizzen und Zeichnungen aus früher Jugendzeit in Niederschlesien, dann auf dem Flüchtlings-Treck gen Westen und später vor der Bewerbung an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden meinte sie, die interessierten ja heute wohl kaum noch, und überhaupt: was gäbe es schon Besonderes zu erzählen, das Ganze wäre ihr irgendwie ziemlich peinlich. Zaghaft ließen sich dann doch die Dialoge an.
Nun gut, am Ende hatte ich nach vielen Gesprächs- und Anschauungs-Stunden alles zusammen für eine anständige, angemessene Veröffentlichung und sogar noch mehr als ich zu erfahren hoffte, und manchmal war Margarete Jahny richtig in Fahrt gekommen. Etwa, wenn sie von ihren Begegnungen als junge Absolventin in der Keramikindustrie mit alten Produktionshasen erzählte oder von der Ignoranz staatlicher Binnen- und Außenhändler gegenüber neuen Gestaltungslösungen. Als sie unserem Werk schließlich den Segen zum Abdruck gab, auch meiner Bildauswahl und meinem Layout und dem Titel, da kam dann dieser eine Satz von ihr: „Ach Herr Höhne, ich hatte erst solche Angst vor ihnen, ich kannte Sie doch gar nicht, aber jetzt ist alles gut“, und sie schenkte mir eines ihrer letzten beiden fabrikneuen Originale der Alfi-Isolierkanne, deren Bild die Einladung für diesen heutigen Abend ziert. Da nun war ich sprachlos.
Warum diese einleitenden Erinnerungen an die Entstehung jenes – längst vergriffenen – Büchleins mit dem Titel Die Anmut des Rationalen? Ganz einfach: Ich möchte Ihnen vorschlagen, sich darauf einzulassen, dass ich Ihnen statt eines akademischen „Vortrags“ zu den Bildern aus Margarete Jahnys Schaffen die eine und andere Passage aus dem Buch lese, an anderen Stellen auch frei etwas kommentiere. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden und erhalten so auch Anregung zum anschließenden Gedankenaustausch miteinander.
Zunächst aber noch ein Wort zu dem Falt-Poster „Das Beste für den Werktätigen“, das Sie hier sehen, zweiseitig bedruckt und für die Ausbildung „Industrielle Formgebung“ an der Dresdner Hochschule werbend, die Margarete Jahny seit 1948 besucht:
Es stammt aus ihrem Besitz und zeigt unter anderem Teile aus dem 1951 geschaffenen Kindergarten-Geschirr des VEB Steingutwerk Dresden (vormals Villeroy & Boch), von dem im Folgenden die Rede sein wird.
Eigentlich wollte Margarete ja Malerei und Grafik studieren, Talent dafür hatte sie ja wahrlich. Aber dann kam es doch anders. Dazu an dieser Stelle Passagen aus dem Schluss des 1. Kapitels mit der Überschrift „Von Talent, Treck und Trümmern“, in dem von der Flucht aus Schlesien im Februar 1945 erzählt wird, vom Zeichentalent Margarete Jahnys und ihrem Studium in Dresden:
Endlich malen und zeichnen können und das Malen- und- Zeichnen-Können richtig lernen! Erich Fraas ist ihr Lehrer im Grundstudium, das 3. Semester absolviert sie in der Fachklasse von Josef Hegenbarth. Der geniale Künstler und beliebte Lehrer, hinter dessen eher schroffen, dynamischen Federzeichnungen sich eine tiefe Sensibilität verbirgt, „schmeißt“ mitten im Semester den Lehrauftrag, vertrieben vom Wetterleuchten der am Horizont heraufziehenden „Formalismusdiskussion“, mit der die „Partei der Arbeiterklasse“ ihre Spielart der Marsch-Partitur „Entartete Kunst“ intoniert. Theo Richter und Lea Grundig treten an Hegenbarths Statt.
Margarete Jahny nimmt alles mit, was ihr an der Hochschule geboten wird. Im Abendstudium steht Aktzeichnen auf dem Ausbildungsprogramm, und in den Semesterferien bietet auf Initiative des nunmehrigen Rektors Mart Stam die Arbeit in der Hochschul- Keramikwerkstatt Gelegenheit zum Gelderwerb. Lehrende und Studierende entwerfen und produzieren hier Unikate und Kleinserien für den Verkauf. Denn die Dresdner schicken sich an, ihre zerbombte Stadt wieder bewohnbar zu machen. Zweckmäßige und schöne Küchen- und Tafelgefäße für die sich erst allmählich wieder vervollständigenden Haushalte sind sehr gefragt. (…)
Nicht lange, und es hat Margarete Jahny „erwischt“: Die Keramik zieht sie immer mehr in ihren Bann, besonders, wenn Glasuren gebrannt werden. Erinnert sie sich daran, leuchten ihre Augen heute wie damals: „Wenn der Ofen aufgemacht wurde, war das immer wie Weihnachten: die Überraschung, was da nun wohl herauskam.“ Der endgültige Wechsel von der Grafik hinüber zum Keramikstudium ist beschlossene Sache.
Die Gestaltungslehre an der Dresdener Kunsthochschule wird Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre vor allem von Rudolf Kaiser und kurzzeitig, aber sehr nachhaltig auch von einstigen Bauhäuslern geprägt: Mart Stam, Hajo Rose – und Marianne Brandt in der Keramikwerkstatt. Marianne Brandt folgt dem 1950 von Dresden nach Ostberlin wechselnden Mart Stam zu Margarete Jahnys tiefem Bedauern im Jahr darauf, dennoch hat das Studium bei der ehemaligen stellvertretenden Leiterin der Metallwerkstatt am Bauhaus Dessau in der angehenden Gefäßgestalterin Jahny wegweisende Eindrücke hinterlassen, die sich später zu konsequenten Schaffensprinzipien für ein ganzes Berufsleben herausbilden sollen: „Sie und Mart Stam haben uns die sachlich und ästhetisch vollendete Form nahegebracht, Verantwortungsgefühl für die industrielle Serie. Und sie haben uns vor allem auch vermittelt, dass man nicht nur genau über die technologischen, sondern auch über die industriellen Realitäten und Prozesse Bescheid wissen muss, um frühzeitig zu erkennen, wo und warum Fehler bei der Produktion des Entwurfs entstehen können und wie man die vermeidet.“
Auffällig an der Lehre Marianne Brandts in Dresden ist noch etwas anderes: Eigenartigerweise bringt sie niemals ausdrücklich Erkenntnisse aus der Bauhauslehre ein, und auch ihre eigenen Weimarer und Dessauer Formlösungen dienen im Studium nicht als Beispiele. „Sie hat völlig frei davon mit uns gearbeitet. Das Bauhaus an sich war kein Thema, sondern zum Beispiel das Ei als funktional und ästhetisch perfekte Form und raumsparendes Stapeln von ineinander greifenden Gefäßen.“
Vor diesem Hintergrund ist es besonders bemerkenswert, dass das Porzellan-Teeservice, das Margarete Jahny im vierten Studienjahr 1952 als Abschlussarbeit ausführt, dann doch einige zwar völlig unbewusste, aber um so erstaunlichere Analogien zu konkreten Arbeiten der ehemaligen Weimarer Bauhäusler Otto Lindig und Theodor Bogler aufweist, die diese Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre für die Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe schufen. Und auch die deutliche Formverwandtschaft einer 1951 am Berliner Institut für angewandte Kunst entworfenen Teekanne Marianne Brandts mit der damals gerade entstehenden Jahny’schen Abschlussarbeit lässt Schlüsse auf nahezu zwangsläufig erscheinende funktional-ästhetische Kontinuitäten im Geschirr der Moderne von den zwanziger und dreißiger Jahren bis herüber in die fünfziger zu, ohne dabei den Geist des Bauhauses als einzigen Sinnstifter herbeizitieren zu müssen oder zu können.
Noch bevor Margarete Jahny mit Erfolg ihre Abschlussarbeit verteidigt und 1953 das Studium in Dresden als Diplom-Keramikerin abschließt, erweist sie sich mit einem ersten Steingutgeschirr-Entwurf (und dies unmittelbar nach dem Wechsel vom Grafik- zum Formgestaltungsfach) bereits als auf dem Weg befindlich zur Gestalterin von konkret-zweckmäßigen Massenprodukten. Ihr im Rahmen der Verkaufsausstellung der Hochschul-Werkstätten 1951 vorgestelltes Serienmuster hat sie unter der Betreuung von Rudolf Kaiser entwickelt. Es ist zum Gebrauch in kommunalen und betrieblichen Kindereinrichtungen bestimmt, die jetzt allerorts in der DDR entstehen. In der Regel sind hier die Kinder der Trümmerfrauen, Industriearbeiterinnen und -arbeiter und sonstigen „Werktätigen“, die das „Auferstanden aus Ruinen“ Wahrheit werden lassen sollen, gut aufgehoben, jedenfalls unterkunftsmäßig. Woran es oft noch sehr mangelt, sind geeignete Gerätschaften und Ausstattungen für ein kulturvolles Gemeinschaftsleben.
Margarete Jahnys Form-Ensemble besteht im Kern, neben Krug und Bechern, aus kindgemäßen Tassen mit zwei (!) Henkeln und einer besonders praktischen und robusten 5-Liter fassenden Kanne mit drei Griffen: Einem direkt vom Korpus sich erhebenden Bügel zum Tragen und zum sicheren zusätzlichen Handhaben beim Einschenken, dem üblichen seitlichen großen sowie einem kleinen Griff am Deckel. Die Berliner Designjournalistin Dagmar Lüder, die über dreißig Jahre später das Geschirr in der Zeitschrift form+zweck eingehender würdigt, schreibt: „Die Entwicklung verläuft im Sinne der Ideale: Zusammenarbeit mit den Nutzern, Zusammenarbeit mit dem Hersteller, Vermittlung der Bedürfnisse beider (…). Es kommt zur Nullserie im VEB Steingutwerk Dresden und zur Premiere im Kindergarten.“
Einen ersten sehr enttäuschenden Dämpfer hingegen, der die junge Absolventin frühzeitig mit der weit verbreiteten Hersteller-Ignoranz gegenüber neuen, aus traditionellen Linien ausbrechenden Formen konfrontiert, erleidet Margarete Jahny mit ihrer schönen Abschlussarbeit: Das während eines Praktikums im Porzellanwerk Reichenbach entstandene Teeservice, für die manufakturmäßige Produktion ausgelegt, wird 1953 weder dort noch in der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen, ihrer zweiten Hoffnung, für die Herstellung in Erwägung gezogen. Zu modern, zu riskant für einen erfolgreichen Absatz im Handel, lauten die Bedenken. Die seit zwei Jahren als ideologische Säuberungsaktion nun auf Hochtouren laufende „Formalismusdiskussion“, die Mart Stam schließlich von der Hochschule für angewandte Kunst in Berlin-Weißensee vertreibt, zeitigt auch auf dem Gebiet der Industriekultur Wirkung.
Mit ihrem Abschlusszeugnis in der Tasche – „Diplom-Keramikerin – Gefäßgestaltung für die Industrie“ steht darauf – findet Margarete Jahny 1953 Anstellung im Porzellanwerk Weißwasser. Man drängt sie zwar, sogleich direkt nach Berlin zu kommen, ans 1950 von Mart Stam gegründete „Institut für angewandte Kunst“, aber sie will erst einmal in die Produktion und dort erfahren, „wie es lang geht an der Basis“. – Dazu diese kurze Monografie-Passage aus dem Kapitel „Kunst- und Lebensschule Praxis“:
Sie ist nicht nur die erste Gestalterin in einem „reinen Männerbataillon mit entsprechendem Umgangston“, wie sie sich lächelnd erinnert, sondern zudem noch „eine Diplomierte, wahrscheinlich ‘was Besseres“. Heute wissen wir: Überhaupt ist sie damals die erste ostdeutsche Industriedesignerin mit Hochschulausbildung in der Branche.
Nein, gleich ‘ran an eine eigene Serie lässt man sie natürlich nicht. Aber Ergänzungsteile fürs laufende Sortiment darf sie schon mal machen und ansonsten vieles von dem, was eben sein muss in so einem Betrieb und was eine studierte Frau vielleicht auch besser kann – die lästigen Abrechnungen für die Formgießer zum Beispiel „und solch einen Kram“. Den zu kennen und gar zu beherrschen, soll sich indes als ungemein wertvoll erweisen bei ihrem späteren Wirken in der Industrie. Wie auch die Erfahrung, dass viele Mängel in der Endproduktion ihre Ursachen in frühen Entwurfsphasen haben, bei den Modelleuren und Gipsern. „Ich bin schon in Weißwasser den Dingen immer auf den Grund gegangen: Wo ist der Fehler entstanden und warum? Das hat mir Respekt verschafft.“
Mindere Gestaltungsqualität, das erkennt sie hier und findet sich später auch andernorts immer wieder bestätigt, ist ihren Ursachen nach nicht nur im mehr oder weniger unzureichenden Vermögen beim Umgang mit technischen Problemen und technologischen Klippen auszumachen, sondern oft auch im Ausbüxen vor anspruchsvollen, aber durchaus zu bewältigenden Alternativen gegenüber dem Althergebrachten. „Bestimmte Radien beispielsweise, die man als Formgestalter haben wollte, stießen in der Industrie nur deshalb auf Widerstand, weil sie ,ein bissel schwierig’ anmuteten. Da hat man eben immer wieder lieber die schlaffen Linien gefertigt, denn die ließen angeblich weniger Fehler zu. In Wahrheit hätte man nur etwas sorgfältiger und mit weniger Routine arbeiten müssen.“
Nach einem Jahr in Weißwasser fühlt sich Margarete Jahny nun einigermaßen gewappnet, dem nach wie vor drängenden Ruf nach Berlin ans Institut zu folgen.
Als die Einunddreißigjährige hier zu arbeiten beginnt, werden in dem nach der Bombardierung notdürftig instand gesetzten Restgebäude unweit des Bahnhofs Friedrichstraße noch handfeste Gestaltungs-Pionierleistungen initiiert und vor allem: vorgemacht, von gestandenen Fachleuten aus den unterschiedlichsten Disziplinen des Industriedesigns. Damals ist das Institut noch keine Verwaltungs-, Begutachtungs- und Repräsentations-Institution im Dienste der „zentralen Leitung und Planung der sozialistischen Volkswirtschaft“, zu der es in den sechziger und siebziger Jahren, dann als Amt für industrielle Formgestaltung, radikal umfunktioniert werden soll.
„Für mich war sehr wichtig, dass man hier praktisch arbeiten konnte“, unterstreicht Margarete Jahny. „Zwar gab es keine Brennöfen für uns drei Gefäßgestalterinnen, aber Gipsbänke, Drehscheibe und auch eine Werkstatt für Glasarbeiten.“
Ab und zu kommt es hier in der Clara-Zetkin-Straße noch einmal zu einem – diesmal kollegialen – Zusammentreffen mit Marianne Brandt, die gelegentlich hereinschaut, wo sie bis vor kurzem selbst noch angestellt war. Sie hat das einstmalige Institut Mart Stams, mittlerweile einundsechzigjährig, „rentenberechtigt“ und wohl nicht viel Gutes ahnend für die Zukunft ihrer Zunft, verlassen, kurz bevor hier Margarete Jahny eintritt.
Wieder aus dem Buch, Überschrift „Arbeiten für die Serie“:
Noch ist die Tätigkeit im Institut für angewandte Kunst, in dem jeder jeden kennt, aufs engste mit der Praxis in den Industriebetrieben verbunden. Die Berliner Gestaltungsspezialisten für Haushaltwaren und -geräte, Möbel, Kunsthandwerk, Raumtextilien und Tapeten, Leuchten, Büro- und Fernmeldetechnik, Fahrzeuge und Investitionsgüter entwerfen eigene Produktvorschläge für die Industrie oder begleiten die dort entwickelten Neuerungen beratend von der Entwurfs- bis zur Herstellungsphase. Allenthalben fehlt es in den „Volkseigenen Betrieben“ noch an professionellen Gestaltern, zudem auch an souveränen, erfahrenen Betriebsleitungen mit einem gewachsenen Gespür für Unternehmenskultur. Frauen und Männer im Alter Margarete Jahnys verkörpern die erste Reihe einer neuen, der Nachkriegs-Formgestaltergeneration im Osten Deutschlands. „Wir fuhren ständig vor Ort, um direkt in der Produktion zu beraten, zwischen Gestaltern und Werkleitern zu vermitteln, Anregungen zu geben und immer wieder auch selbst welche mit nach Berlin zu nehmen“, schildert Margarete Jahny diese bis Anfang der Sechzigerjahre währende intensive Phase der künstlerischen Einflussname auf das sich allmählich profilierende Erzeugnisangebot in der DDR-Industrie. „Aber unsere Visiten in den Betrieben lösten – im häufigen Gegensatz zum Echo seitens der gestalterisch oft unsicheren Produktenwickler – bei den Werkdirektoren selten freudiges Entgegenkommen aus. Bei einigen änderte sich das nach und nach.“
In der keramischen Industrie spricht es sich bald herum: Mit der Frau Jahny kommt da eine, die sehr viel vom Fach versteht – und eine, die nicht nur genau hinguckt und gut gemeinte Ratschläge erteilt, sondern sich selbst mit hinsetzt und modelliert, ja aus Berlin sogar mit fertigen Gipsformen, genau für den Brand berechnet, anreist. Bloße Stippvisiten gibt es für sie kaum, meist ist sie mit dem Übernachtungszeug in der Tasche unterwegs. Bald ist sie bei allen namhaften ostdeutschen Herstellern zu Hause: im sächsischen Sörnewitz wie in Torgau oder Colditz, im brandenburgischen Elsterwerda, in Ilmenau, Lichte und Wallendorf, Kahla und Römhild in Thüringen. Sie berät, sie lernt selbst dazu, und immer wieder bringt sie eigene Ideen unmittelbar in die Erzeugnisentwicklung ein. Manche nimmt noch auf dem Weg zum Hersteller endgültig Gestalt an, eine nächste schon wieder während der Heimfahrt im Eisenbahnabteil. Immer hat Margarete Jahny ihren Notizblock bei sich, auf dem sie Ihre Skizzen festhält – meist bereits in frappierender Übereinstimmung mit dem später tatsächlich hergestellten Fabrikat.
Lassen Sie mich hier nun bezeichnenden Details des Lebenswerks von Margarete Jahny zuwenden – Entwürfen, die sozusagen mit Leib (also Gegenständlichkeit) und Seele (also der Ästhetik) die Schaffensprinzipien der Gestalterin widerspiegeln. Die da wären: lange Brauchbarkeit mit anhaltender Freude an der Erscheinung der Dinge zu verbinden (hierfür gibt es ja das schöne deutsche Wort des „Nutznießens“!), dabei alles Scheinbare zu vermeiden und stattdessen Wahrheit, Echtheit in das Antlitz von Gebrauchsgerät zu verlegen, immer ein Höchstmaß an physischem und psychischem Gebrauchswert zu schaffen. Und zwar umso beharrlicher, je schwieriger sich die objektiven und subjektiven Umstände hierfür erweisen.
Meine folgenden Ausführungen können im gebotenen Zeitrahmen nur stichpunktartig ausfallen, aber vielleicht ergattern Sie irgendwo noch antiquarisch dieses Büchlein, dem Sie Detaillierteres entnehmen können.
Das erste Industrieprodukt Margarete Jahnys, das groß in Serie geht, ist das 1960 in den Handel gelangende Topf-Set „Vom Herd zum Tisch“ aus dem Aluminiumwerk Fischbach in der Rhön, vormals „Alfi“. Also keine Keramik- oder Porzellan-Kreation, sondern Metallgerät aus einem bis dato eher geringschätzig betrachteten Material, aus Aluminium. Margarete Jahny gelingt es nicht nur, hier mit ihrer Formenlösung alles althergebrachte „Topfige“ vergessen zu lassen, sondern den einzelnen Bestandteilen der Gefäße zum Teil neue Funktions-Entfaltungsmöglichkeiten zu eröffnen: Die Topfdeckel können gleichwohl als Servierschalen und Vorlegeplatten dienen, die eigenwillig anmutenden Griffschalen etwa sind nicht formalistisch, sondern funktional genau deshalb so und nicht anders geformt. Aber das Nonplusultra des Gefäßgestaltungsprinzips, das sieht man überhaupt nicht! Das sind nämlich die Topfböden mit ihrer optimalen Dicke für einen energiesparenden und nährstoffgerechten Garprozess. Dafür hat sich die Gestalterin in vielen Gesprächen und bei mannigfaltigen Versuchen von Spezialisten des staatlichen Potsdamer „Zentralinstituts für Ernährung“ intensiv beraten lassen. Auch den Handel mit seinen Belangen bezog sie von Anfang an in die Produktentwicklung mit ein. Ein komplexes Herangehen mit wissenschaftlichem, technologiegerechtem handwerklichen und künstlerischem Anspruch, wie es auch für sämtliche künftige Jahny-Entwürfe (und später auch für ihre Lehrtätigkeit an der Kunsthochschule Berlin) so typisch sein soll.
Ende der 1920er Jahre tritt das Unternehmen Alfi mit einer neuen Generation von Isolierkannen auf den Markt, holt sie sozusagen aus dem Schichtarbeiter-Aktentaschenimage heraus auf den bürgerlichen Kaffeetisch, mit leichter Verbeugung vor einstigen fürstlichen Barock-Tafeln. Dieses Modell ist bis Ende der fünfziger Jahre „der Mercedes-Benz“ von Alfi, sowohl im westdeutschen Wertheim, wo sich die Firmeninhaber nach der Enteignung 1949 eine neue Existenz aufgebaut haben, als auch im VEB AWF.
Zeitgleich mit ihrer Arbeit an „Vom Herd zum Tisch“ widmet sich Margarete Jahny in Fischbach der Gestaltung einer modernen, sachlichem Zeitgeist entsprechenden Isolierkanne. Die ökonomischen und technologischen Anforderungen des Betriebes für die Entwicklung sind klar gesetzt: reduzierter Materialverbrauch, weniger Teile für das Endprodukt, insgesamt preisgünstigere Produktion. Das Ergebnis: ein Gebrauchsgerät in einmaliger schlichter Eleganz, eine Tischzierde, die gleichsam den barocken Reifrock gegen das Reformkleid des 20. Jahrhunderts ausgetauscht hat. Für mich bis heute die schönste „Thermoskanne“ der Welt.
Seit 20 Jahren versuche ich immer wieder, noch einmal einen Produzenten dafür zu gewinnen, vergeblich. Ich spannte unter anderem „Manufactum“ und auch den für Alfi in Wertheim tätigen und mit mir befreundeten Designer Tassilo von Grolmann ein, die Wertheimer für eine Neuauflage der Jahny-Kanne zu gewinnen. Vergebens. „Wir denken nicht daran, etwas zu produzieren, das in unserem von den Kommunisten enteigneten Betrieb gemacht wurde.“
Die Wunde scheint offenbar nicht vernarben zu wollen. Und so weist Alfi Wertheim auch noch nach der deutschen Wiedervereinigung seine aktuellen Produkte (wie die etwas modifizierte barockisierende Kanne, die auf den Kabinettstischen sämtlicher Bundesregierungen bis heute obligatorisch thront) mit dem trotzigen „Boden-Satz“ aus: alfi Western Germany. Obwohl es im ostdeutschen Fischbach schon längst kein Aluminiumwerk mehr gibt.
Übrigens: Deutlich für viele Jahre erkennbar sind noch die Spuren, die Margarete Jahnys Wirken in Fischbach hinterlassen hat: Das gesamte Produktsortiment für den Haushalt erhält ein anderes, modernes Gesicht, auch als die Gestalterin bereits wieder anderswo gefragt ist.
Margarete Jahny sagt, sie selbst hätte viel Glück gehabt mit ihren Auftraggebern und Partnern in der Industrie, das wären in den meisten Fällen neuen Gestaltungsvorschlägen gegenüber aufgeschlossene Leute gewesen. Dies trifft insbesondere auch um 1960 auf das Porzellanwerk Wallendorf in Thüringen zu, wo sie eine Heimstatt findet für ihre keramische Experimentierlust in puncto Serienporzellan. Und nicht nur sie: auch für andere Gestalter wie Heiner Hans Körting, Hans Merz, Hubert Petras oder Ludwig Zepner (später Chefentwerfer in der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen) wird Wallendorf zu einem regelrechten Wallfahrtsort, wo sie der allgemeinen, vom Handel abgeforderten Dekorations-Inflation entfliehen und sich in edlen weißen Formlösungen versuchen dürfen – bis sie und der Werkleiter mit dem schönen Namen Habedank von den Berliner SED-Kulturdiktatoren scharf zurückgepfiffen werden unter dem öffentlichen Vorwurf, „kalten Funktionalismus“ und „farblose Eintönigkeit“ zu betreiben und mit ihren Experimenten den Exportplan zu gefährden, was an Wirtschaftssabotage grenze.
Die von Margarete Jahny für die Serie entworfenen Wallendorfer Glieder- und Kragenvasen sind heute Klassiker der besten Jahre des DDR-Designs und leider nur sehr, sehr selten zu bekommen. Wer sie dereinst vor 50 Jahren im staatlichen Kunsthandel ergatterte, hütete sie wie den eigenen Augapfel, und offenbar sieht auch die nachkommende Erben-Generation keinen Grund, sie auf Trödelmärkte zu tragen.
Man fragt sich heute, wie diese kleine, leise Frau das alles zustande brachte damals Anfang der sechziger Jahre, von Berlin aus ständig auf Achse. Denn in diese Zeit fällt auch ihre wohl anspruchsvollste Entwurfsarbeit in Sachen Glas, seriellem Pressglas. 1961 verlassen die ersten Teile von „Luzern“ das Lausitzer Werk in Schwepnitz. Die in verschiedenen Farben hergestellten undekorierten Schalen, Vasen und Kerzenhalter finden reißend Absatz und werden sogar massenhaft exportiert – auch in die Schweiz, wie Margarete Jahny lächelnd zu berichten weiß.
Dass „Luzern“ überhaupt ungewöhnlich rasch vom Entwurf in die Massenproduktion umgesetzt werden kann, ist vor allem auch einem Mann zu verdanken, dessen handwerkliches und gestalterisches Wirken sich ab Ende der 1950er Jahre immer enger mit dem von Margarete Jahny verbindet: Erich Müller ist im Institut für angewandte Kunst seit 1957 für Glasgestaltung zuständig und selbst ein in der Branche hoch angesehener Fachmann. Er erreicht dank seiner Reputation, dass das ihn auf den ersten Blick überzeugende „Luzern“-Konzept umgehend Eingang in die Produktion findet.
Der Erfolg mit „Luzern“ ermuntert den Betrieb, sich auf ein weiteres Experiment des Gespanns Müller/Jahny einzulassen. Vor dem Hintergrund der sich zu jener Zeit in der DDR formierenden Vereinigung INTERHOTEL als Leitorgan für einmal 26 Interhotels mit 12.000 Betten und über 15.000 Gaststättenplätzen entwickeln die beiden das stapelfähige Gastronomie-Sortiment „Europa“ aus olivfarbenem Pressglas, das ab 1965 das Schwepnitzer Glaswerk verlässt, hergestellt auf einer West-Importmaschine. Die hatte der Betrieb auf Grund des devisenbringenden Erfolgs von „Luzern“ anschaffen dürfen. Die Entwicklung von „Europa“ selbst erweist sich aber als ziemlich zeitaufwendig, denn es fehlen einfach empirische Ausgangsdaten dafür, welche Portionsgrößen etwa in der Gastronomie gang und gäbe sind. Erst dann macht ja die Stapelfähigkeit wirklich Sinn, wenn sie nicht nur in Richtung Geschirrschrank bedacht wird, sondern auch hinsichtlich des Servierens. Margarete Jahny erzählt: „Die Europa-Kompottschälchen waren beispielsweise am Ende so beschaffen, dass sie auch in gefülltem Zustand übereinander gesetzt transportiert werden konnten, ohne dass der Boden der aufgesetzten Schale im Pudding saß.“ Man fährt immer wieder mit den Gipsmodellen in Hotels, damit die Küchenchefs und Servierer sehen und anfassen können, was das Optimale für sie wäre.
Als das Sortiment dann in Dienst gestellt wird, ist es vor allem das jüngere Personal, das sich mit ihm rasch identifiziert. Ein altgedienter Oberkellner in einem Leipziger Interhotel hingegen meint, als er von Margarete Jahny um sein Urteil gebeten wird: „Nu, das sin ja de reensten Karnickelnäppe!“
Eine der erhaltenen Jahny’schen Entwurfsskizzen, die sie auf Eisenbahnfahrten und in Wartesälen gezeichnet hat, zeigt erste Überlegungen zu einem stapelbaren Gastronomie-Porzellansortiment für Hotels, Selbstbedienungsgaststätten, Ferienheime und Kantinen, das sie dann zusammen mit Erich Müller für den VEB Vereinigte Porzellanwerke Colditz unter der Bezeichnung „Rationell“ entwickelte. Die beiden Jahny- und Müller-Zeichenblätter in ihrer Gegenüberstellung bestätigen übrigens nachvollziehbar einen Satz, den mir Margarete Jahny einmal zum schöpferischen Verhältnis zwischen ihr und Erich Müller sagte: „Er war als Gestalter der Mann der strengen Zweckbetontheit, was mir manchmal etwas gegen den Strich ging. Aber wir haben uns stets zusammengerauft“.
Zu „Rationell“ hier noch einmal aus dem Jahny-Büchlein:
Als EUROPA „läuft“, machen sich Jahny und Müller – die übrigens vornehmlich immer noch beratend und begutachtend die gesamte Glas- und Keramikindustrie der DDR bereisen – über ein weiteres dringend zu lösendes Serien-Problem her: Überall im Gastronomiewesen fehlt es an robustem und zugleich ansehnlichem stapelbaren Porzellan. Gebräuchlich sind vom gutbürgerlichen Haushaltsgeschirr abgeleitete „gemütliche“, auch mehr oder weniger gelungene „elegante“ Formen. Als zeitgemäße gestalterische und funktionale Alternative schwebt dem Gestalter-Duo hingegen etwas, wie Mararete Jahny sich ausdrückt, „für den deftigen, derben Gebrauch Zuständiges“ vor, das in Nutzungsanliegen und Formverwandtschaft absichtsvoll mit dem klaren EUROPA-Gestus korrespondieren, in der Restaurantpraxis zusammen funktionieren soll.
1969/70 entstehen die ersten Kaffeeservice-Teile des Hotelgeschirrs RATIONELL, das zu einem der absoluten Markenzeichen von Colditz, ja zu einem typischen DDR-Massenprodukt werden soll – und zu einem, das die DDR sogar bis heute als Gebrauchsporzellan überlebt hat, obwohl seit 1990 nicht mehr hergestellt.
Als ein hartnäckiges Problem erweist sich von Anfang an, dass die vorhandene Colditzer Technologie mit der speziellen Kännchendeckel- Innenausformung im wahrsten Sinne des Wortes „nicht zurande kommen“ will. Die ist vom Design her so ausgelegt, dass sie das Eingießen ohne Festhalten ermöglichen soll. Das dazu angemeldete Patent stammt von Erich Müller. „Und dann passierte folgendes“, ärgert sich Margarete Jahny noch heute: „Ehe das langwierige Patentverfahren ganz ,durch’ war, wurde RATIONELL schon auf einer Leipziger Messe in der Verhandlungskoje voller Stolz westdeutschen Handelsvertretern gezeigt – und kurze Zeit später nach genau diesem Vorbild ein sehr ähnliches Hotelservice bei Bauscher in Weiden produziert: mit passgenau innen ausgeformtem Deckel, wie er im DDR-Betrieb bei fehlender Technologie in so kurzer Zeit für die Großserie nicht hinzubekommen war…“
Die RATIONELL- Serie läuft fast zwei Jahrzehnte lang vom Band, erweitert um Speisegedeck-Teile, immer mal wieder auch von den Werksgestaltern „modifiziert“. Nur in den ersten Jahren können Jahny/Müller darüber wachen, dass das Konzept originalgetreu umgesetzt wird. Überhaupt nicht zu beeinflussen ist allerdings, wie die RATIONELL-Kännchen später mit einer ausufernden Vielzahl von Schiebebild-Neckischkeiten dekoriert wird. „Wir hatten einfache, unterschiedlich farblich abgestimmte Banddekors vorgeschlagen, aber es kam zu einem wilden Selbstlauf unzähliger so genannter ,haushaltsfreundlicher Varianten’.“
Das letzte gemeinsame Projekt von Jahny und Müller (Erich Müller geht 1972 in Pension) ist ein stapelbarer Gläsersatz für den Gastwirtschafts- und Hoteleinsatz, genannt „Wirtegläser“. Es sind dies handliche Becher in verschiedenen Größen, ab 1973 im VEB Kombinat Lausitzer Glas zwar produziert, aber meiner Erkenntnis nach nur in der Größe 0,25 Liter und in kleiner Auflage. Warum dies, ist mir nicht bekannt, aber ich vermute, wieder einmal wird es der Handel gewesen sein, der diese reduzierten, geradlinigen Produkte nicht haben wollte, zunächst jedenfalls.
Seltsamerweise wird dann 1980 vom Schwepnitzer Kombinatsbetrieb ein Re-Design mit vergröberten Proportionen und im Gesamtquerschnitt eingeschränkter Stapelbarkeit, aber nun strapazierfähigerer Glasqualität unter dem neuen Handelsnamen „superfest“ aufgelegt, das noch im gleichen Jahr die staatliche Auszeichnung „Gutes Design“ zuerkannt bekommt. Die Plakette darf ein als Urheber genanntes dreiköpfiges Betriebs-Gestalterkollektiv entgegennehmen – von Margarete Jahny und Erich Müller als den Autoren des Originals ist keine Rede mehr. Dieser Bechersatz wird in den achtziger Jahren das DDR-Bier- und Limonadenglas schlechthin.
Als Erich Müller 1972 in Rente geht, erhält das Berliner Institut einen neuen offiziellen Status, wird zum „Amt für industrielle Formgestaltung“ beim Ministerrat der DDR. Von da an ist es vorbei mit kontinuierlichen, intensiven Vor-Ort-Beratungen in der Industrie und eigenständigen Produktentwicklungen aus dem Hause, und auch Margarete Jahny ist dazu verurteilt, nur mehr als Gutachterin und Prädikatisiererin zunehmend bürokratisch zu wirken. Etwas, das Gift für das Naturell ihrer so sensiblen wie praktisch orientierten Persönlichkeit ist. Schließlich gelingt es ihrer Kollegin Christa Petroff-Bohne, Professorin an der Kunsthochschule Berlin, sie 1979 dorthin zu holen als Lehrbeauftragte im Fachbereich Keramik / Baukeramik, wo sie bis 1990 wirkt und bleibende Spuren im Schaffen der bei ihr Hörenden, Sehenden und Formenden hinterlässt, wie etwa beim damaligen Praktikanten und heutigen Keramik-Professor an der Hochschule für Kunst und Design Halle, Burg Giebichenstein, Hubert Kittel, der sich an Margarete Jahny als „leise, freundliche und überzeugende Projektbetreuerin“ erinnert und sie zu den DDR-Formgestaltern zählt, „die vor allem dem Glas- und Keramikdesign in den 60er Jahren, nach Mauerbau und wirtschaftlicher Konsolidierung, einen bedeutenden Modernitätsschub verliehen haben“.
Ihr ehemaliger Kollege im Institut und im AIF Jürgen Peters, selbst ein Formgestaltungs-Pionier der fünfziger und sechziger Jahre, hat in meiner Schrift über sie 1998 etwas sehr Beeindruckendes gesagt:
„Margarete Jahny schaffte es auf ihre zurückhaltende, freundliche und zugleich unbeirrbare Art, in den Betrieben immer mehr auf Gegenliebe zu stoßen, und zwar buchstäblich. Sie hatte etwas, was viele der noch so routinierten Gestalter nicht besaßen: ein untrügliches Gefühl für eine Tasse, aus der man trinkt, und für eine Kanne, aus der man gießt. Margarete Jahny hatte die Gabe, „Flüssigkeiten zu denken“ in den Entwürfen. Sie war dabei nicht etwa eine künstlerisch wahnsinnig ambitionierte Entwurfszeichnerin, deren Vorlagen die Modelleure begeistert von den Hockern fallen ließen. Ganz kleine, eher unscheinbare Skizzen waren das, in denen die Ideen steckten, manchmal nur auf Rechenkästchenpapier hingesetzt. Aber was die aussagten! Die waren sehr stark vergeistigt. Sieben Striche waren sieben Gedanken.“
Margarete Jahny lebt heute zurückgezogen, glücklicherweise Verwandte in der Nachbarschaft habend, in Schmerlitz bei Kamenz. Auf dem Weg zu ihr, den wir ein-, zweimal im Jahr antreten, haben wir vor 7 Jahren auch einmal einen Abstecher zum Glaswerk Schwepnitz gemacht. Das war da nur noch eine vorwiegend Glasschliff für andere Rohware-Produzenten leistende Manufaktur namens „Glasax“, die Formen für „Europa“ und „Luzern“ gab es längst nicht mehr im Lager. 2006 übernahm dann ein westfälischer Unternehmer den insolventen Betrieb. Aktuelles ist heute nicht mehr zu erfahren; unter der Internetadresse www.glasax.de erreicht man nur noch die Information: „Sie können diese Domain kaufen!“[/paycontent]
(Vortrag Marianne Brandt Gesellschaft e. V. Chemnitz am 22. 04. 2010)