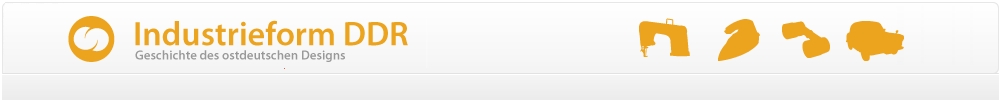Es war Mitte der Fünfzigerjahre, und wir hatten das verrußte Zwickau mit der ländlichen Kleinstadt Großenhain in der Nähe von Dresden ausgetauscht, wo meine Eltern nun begannen, Fuß in ihren neuen Arbeitsstellen zu fassen und ich in einem neuen Grundschul-Klassenverband. Mein westsächsischer Migrationshintergrund brachte hier das eine und andere Adaptionsproblem mit sich, denn ich musste zum Beispiel lernen, nun statt mit „Glückauf“ mit „Guten Tag“ zu grüßen, und beim Gedichte Aufsagen und Lautlesen stach ich mit meiner Unfähigkeit hervor, ein ordentliches „ch“ zu sprechen. Ich sang „Röslein schprach isch bresche disch“ und sagte „zeischnen“ statt „zeichnen“. Im Zeichnen selbst, auch im Lesen und Aufsatzschreiben war ich ansonsten obenauf und errang dadurch dann doch Respekt und neue Schulfreunde. Zeichnen und Malen waren meine Leidenschaft, und auch zu Hause blieb kein leeres Blatt vor mir sicher. Geeignetes Papier für meine Versuche mit Zeichenkohle, Fettstiften, Pastellkreide und Aquarellfarben war damals freilich rar und dazu recht teuer, und so nutzte ich alle auffindbaren Ersatzmöglichkeiten im elterlichen Haushalt.
Eines Tages stieß ich in einer Truhe mit Stoffresten, Schnittmuster- und Papierbogen neben Mutters Nähmaschine auf ein großes, dickes Karton-Heft, das ich für hervorragend geeignet befand für meine Hobbymalerei. Es war zwar einseitig mit irgendwelchen abstrakten Mustern bedruckt, aber die interessant strukturierten gelblichweißen Rückseiten eine klare Herausforderung an meine bildkünstlerische Phantasie.[paycontent] Gerade hatte ich den Wasserfarbenmalkasten auf dem Küchentisch in Position gebracht und den Alpenveilchentopf als Studienobjekt vom Fensterbrett genommen, da ertönte Mutters Aufschrei hinter meinem Rücken: „Aber nicht die Rasch-Tapeten!“ He? Tapeten sollten das sein, so klein wie Geschirrtücher? Die taugten doch höchstens für eine Puppenstube. „Junge, mein Bauhaustapeten-Musterheft nimmst du nicht zum Bemalen“, bekräftigte Mutter. Das nie zuvor gehörte lautmalerische Wort „Bauhaustapeten-Musterheft“ blieb in meinem Gedächtnis haften.
Das war meine erste Begegnung mit dem Bauhaus, damals 1955. In der Schule, im Kunsterziehungsunterricht, hatte und habe ich auch später, als ich Ende der Fünfzigerjahre meine pädagogische Berufsausbildung aufnahm, nie etwas davon vernommen. Auch nicht bei einer Stadtführung durch Weimar, als ich dort 1963 mit Mutter, einer großen Verehrerin Goethes und seines Umkreises, eine Sommerurlaubswoche verbrachte.
1965 (ich arbeitete nun als Junglehrer für Deutsch und Kunsterziehung an einer Landschule vor den Toren der Stadt) erblickte ich im Schaufenster der staatlichen Buchhandelskette „Buch und Kunst“ in Großenhain eine Neuerscheinung, auf deren Titel dieses seltsame Wort Bauhaus meinen Blick bannte und sofort das eingezogene „Malbuch“ wieder vor dem inneren Auge erscheinen ließ : Es war Lothar Langs „Das Bauhaus 1919-1933. Idee und Wirklichkeit“, herausgegeben vom Zentralinstitut für Formgestaltung Berlin. Ich kaufte es natürlich sofort, und tatsächlich: unter der Kapitelüberschrift „Produktgestaltung“ stieß ich gleich auf Mutters Rasch-Tapeten: „Am bekanntesten sind wahrscheinlich die sogenannten Bauhaus-Tapeten geworden, die die noch heute existierende Hannoversche Tapetenfabrik Gebr. Rasch in Bramsche bei Osnabrück herstellte.“
Ich konnte nicht ahnen, welches Wagnis es seitens des Autors und des Herausgebers bedeutet hatte, dieses Buchprojekt anzupacken. Und erst fünfzig Jahre später sollte ich in einem Gespräch mit dem heute 80jährigen Berliner Architektur- und Designhistoriker Karl-Heinz Hüter erfahren, dass zur selben Zeit zwar auch seine Bauhaus-Chronik druckfertig war, es aber noch unglaubliche zehn Jahre brauchte, bis sie erscheinen durfte: „Das Bauhaus in Weimar“. Auch von der ersten (übrigens so bescheidenen wie tapferen) Bauhaus-Ausstellung in der DDR, die 1967 im Dessauer Schloss Georgium gezeigt wurde, bekam ich seinerzeit nirgendwo etwas zu lesen und zu hören. Denn: noch hatten die Medien das totzuschweigen. Das Land lag fröstelnd im Schatten des berüchtigten kulturpolitischen 11. Plenums des ZK der SED von 1965, das einen rabiaten Rundumschlag gegen alles geführt hatte, was nicht der Doktrin der Ulbricht, Honecker, Hager und Genossen von einem „sauberen Staat ohne dem Sozialismus fremde, schädliche Tendenzen und Auffassungen“ entsprach. Und zu diesen beargwöhnten und bekämpften Tendenzen und Auffassungen zählte (wieder einmal) auch das ideelle und materielle Kulturerbe des Bauhauses.
Die erste verheerende Partei-Kampagne gegen die berühmteste Kunst- und Gestaltungsschule des 20. Jahrhunderts, ihre Vertreter und Hervorbringungen war eineinhalb Jahrzehnte zuvor, 1951, auf einer Tagung des Zentralkomitees der SED in Berlin mit der so genannten „Formalismusdebatte“ losgetreten worden. Sie bildete den Auftakt zur Indoktrination des „Sozialistischen Realismus“ stalinistischer Prägung in der DDR und „zum Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur“, gegen „Kosmopolitismus“ und namentlich gegen den „sogenannten Bauhausstil“. Das bedeutete auch einen unmissverständlichen Warnschuss über die Häupter derjenigen, die im Geiste des Bauhauses inzwischen in Ostdeutschland wieder zu lehren und zu wirken begonnen hatten. So arbeiteten an der 1946 als Bauhaus-Nachfolger gegründeten Weimarer „Staatlichen Hochschule für Baukunst und Bildende Künste“ unter anderen die ehemaligen Bauhäusler Peter Keler und Hans Hoffmann-Lederer als Lehrer für die Vorklassen, Rudolf Ortner und Emanuel Lindner für Werklehre und Entwerfen und Gustav Hassenpflug für Städtebau, wirkten zunächst an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und dann in Berlin-Weißensee Marianne Bandt und Mart Stam, hier in Berlin zudem Theo Balden, Albert Buske, Heinrich Kilger, Selman Selmanagic und Klaus Wittkugel. An der Halleschen Burg Giebichenstein waren aus dem Bauhaus-Kreis Friedrich Engemann (Seminar für Bau- und Raumgestaltung), Walter Funkat als Direktor bzw. Rektor und Lothar Zitzmann mit seiner am Bauhausvorbild orientierten Gestaltungs-Grundlehre angetreten, andere einstige Bauhäusler engagierten sich in der ostdeutschen Industrie oder als freie Künstler.
Wer von ihnen auf der Parteikonferenz von 1951 nicht gleich namentlich in Acht und Bann geriet und seine Zelte im SED-Staat eiligst abbrach wie Mart Stam als Rektor in Berlin-Weißensee, sah in ungläubiger Lähmung nun alle Bauhaus-Renaissance-Hoffnungen wie ein Kartenhaus auseinander fallen. Für die trotz alledem Standhaften (auch was ihr Im-Lande-Bleiben betraf) begann eine lange Epoche der Kompromisse und verdeckter Strategien, um den sozial-funktionalen Geist Weimars und Dessaus dennoch am Leben zu erhalten. Wenn auch das gegenständliche nationale Kulturerbe Bauhaus geächtet war – als gesamtheitliches Lehr- und Gestaltungsprinzip blieb es an den ostdeutschen Kunst- und Designschulen präsent. Die Früchte zeigten sich in den Sechziger- bis Siebzigerjahren in Gestalt vieler ostdeutscher Industrieprodukte von hoher funktional-ästhetischer Qualität, entworfen von Schülerinnen und Schülern derer, die sich dem Bauhaus- und Funktionalismus-Verdikt nicht gebeugt hatten.
Und das verkaufte sich nun auch noch wie verrückt im bösen Westen, der mittlerweile zu einem guten, lieben Kunden des staatlichen DDR-Außenhandels geworden war.
Dann, plötzlich, auch dies: Das jahrzehntelang verkommene Bauhausgebäude in Dessau öffnet 1976, pünktlich zum 50. Jahrestag seiner Einweihung, perfekt restauriert bis zur letzten Türklinke, wieder seine Pforten. Der sozialistische deutsche Staat macht nicht nur vor aller Welt auf einmal Staat mit dem guten alten Erbstück, sondern erhebt es gar zum Kronzeugen für seine Kultur- und Baupolitik: Ihm seien schließlich die „Grundideen für die Lösung der heutigen und künftigen Aufgaben (…) wie der Industrialisierung des Bauwesens“ zu verdanken, zitiert das Neue Deutschland aus der Festrede des DDR-Bauministers, und was da an Beton-Massensiedlungen in Berlin-Marzahn, Jena-Lobeda und Leipzig-Grünau in den Himmel schieße, sei genau das, was „viele Vertreter des Bauhauses erträumten, das aber nur im realen Sozialismus zu verwirklichen ist“.
In meiner Geburtsstadt Zwickau lernte ich Mitte der Siebzigerjahre auf der journalistischen Suche nach lebenden Zeugen des Bauhauses den freien Künstler Albert Hennig kennen, Jahrgang 1907 und 1932 als junger Betonbauer und begabter Amateurfotograf in Dessau immatrikuliert. Nach dem Kriegsende hatte er den Zwickauer „Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“ und hier eine Künstlergruppe mitgegründet. 1952 riss ihm die Formalismus-Debatte Pinsel und Palette aus der Hand und ließ ihn bis 1972, bis zum Rentenalter, als Betonbauer daran mitarbeiten, was nach Lesart des Neuen Deutschland „viele Vertreter des Bauhauses erträumten“. Ich lernte ihn nicht als verdrossenen, gebrochenen Mann kennen. Er malte wieder und hinterließ nach seinem Tode im Jahr 1998 der Stadt Zwickau ein umfangreiches, durch und durch lebensbejahendes Werk.[/paycontent]
(Essay anlässlich des 90-jährigen Gründungsjubiläums des Bauhauses in Weimar und zur wechselvollen Rezeptionspolitik der SED gegenüber dem Bauhaus-Erbe zwischen 1945 und 1989 – für Design Report 04/2009)