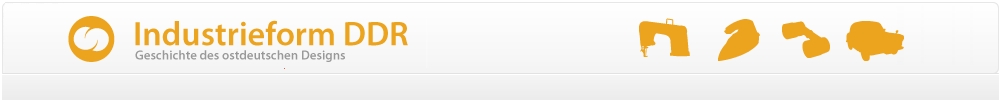Man sollte annehmen, dass zumindest wer früh genug in der DDR aufgewachsen war, mit einer unstillbaren Sehnsucht nach dem „Land, wo die Zitronen blühn“ ausgestattet gewesen wäre. Collodis Pinocchio (alias Burattino aus Alexej Tolstojs Literatenfeder) war auch hier in den fünfziger und sechziger Jahren der Kindheitsgefährte atemloser Lesestunden, die Fee mit den dunkelblauen Haaren das Traumbild erster unschuldiger sexueller Begierde. Tischbeins Goethe-in-Italien-Porträt und Canalettos Städteansichten zählten über Schülergenerationen hinweg zum obligatorischen Literatur- und Kunstbetrachtungsstoff, Italien-Schnulzen nicht nur zum festen Repertoire auf den Tanzböden der Kulturstätten und Klubhäuser, sondern auch zu den Erfolgshits unterm volkseigenen Schallplatten-Label Amiga. Dessen erste Schelllack-Pressung im Schlager-Genre, noch in der Sowjetischen Besatzungszone, hieß „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“. Dreißig Jahre danach, so kursierte seinerzeit in Ostberliner Künstlerkreisen, soll allerdings die Sängerin Milva vom Pförtner des Berliner Ensembles abgewiesen worden sein, als die überall, nur in der DDR nicht bekannte Brecht-Weill-Interpretin sich einmal das Theaterhaus außerhalb der Vorstellungszeiten ansehen wollte.
Hatte man im preußischen „Spree-Athen“ seit jeher weniger mit Italien am Hut denn vielmehr mit Frankreich am Dreispitz, so verhielt sich dies in sächsischen und thüringischen Gefilden ganz anders. Dresden, die DDR-Kulturmetropole Nummer Eins, apostrophierte sich gern als „Elbflorenz“, und die hier als Äquivalent zu Nivea in weiß-blauer Dose bei Elbchemie damals wie heute produzierte Hautcreme hieß und heißt auch deshalb immer noch Florena. Wer in der Dresdener Gemäldegalerie Raffael, Tizian, Tintoretto, Botticelli und – in der Abteilung Neue Meister – auch Guttuso und Mucchi ausgiebig bewundert hatte, versuchte anschließend vis-a-vis im „Italienischen Dörfchen“ einen Restaurantplatz zu ergattern („Sie werden platziert!“). [paycontent]Weil hier am Elbufer im 18. Jahrhundert die italienischen Bauarbeiter angesiedelt waren, die die Dresdener Katholische Hofkirche des Architekten Gaetano Chiaveri errichteten, führte die Traditionsgaststätte diesen Namen – echtes Gelato und Espresso zu DDR-Zeiten allerdings nicht.
Originales oder zumindest originalgetreues mediterranes Flair auf Schritt und Tritt bot auch die Klassikerstadt Weimar dem Ostdeutschen. Goethe als Importeur römischer und italienischer Kunst und Wohnkultur, als Baukünstler sogar des vor gut 200 Jahren für den großherzoglichen Freund Karl August im Park an der Ilm errichteten Sommerrefugiums Römisches Haus, hinterließ hier nicht nur gegenständliche Zeugnisse seiner Italomanie, sondern auch die „Römischen Elegien“, wenn auch letztere nicht durch ein toskanisches oder sizilianisches, sondern durch ein Weimarer Naturkind inspiriert – die junge Fabrikarbeiterin Christiane Vulpius, die im alten Goethe italienische Traum- und Wunschbilder wiedererweckte: „… versteh ich den Marmor erst recht; ich denk und vergleiche, / Sehe mit fühlendem Aug, fühle mit sehender Hand.“
Christiane aber kannte sein Land nicht, wo die Zitronen blühn, und ihre Sehnsucht nach dort hielt sich in Grenzen. So wie Generationen später der an der Spree oder an der Ilm ansässige Goethe-Freund in der 12bändigen Volks-Werkausgabe der Bibliothek Deutscher Klassiker aus dem Aufbau-Verlag Berlin und Weimar (für summa summarum ganze 98 Mark der Notenbank der Deutschen Demokratischen Republik) zwar lesen, aber nicht mitempfinden konnte: „O wie fühl ich in Rom mich so froh! gedenk ich der Zeiten, / Da mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing, / Trübe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich senkte…“
Rom, Italien waren, als 1981 die vierte und letzte Auflage des Ganzleinen-Klassikers mit Goldprägung erschien, für den Ostberliner und Weimaraner weiter weg als der Mond, den man ja wirklich („echt“ heißt das heute) am Himmel erblicken konnte. Italien hingegen, theoretisch nur zwei Flugstunden entfernt, schaute für den real exisitierenden DDR-Normalbürger bloß aus raren Kunstbänden und aus Schul- und Weltatlanten, als putziger Langschaftstiefel, der ins Mittelmeer hineinragt und im tektonischen Kick gegen den Lumpenfußball Sizilien erstarrt ist. Apropos: Internationale Sportereignisse waren es, die den ostdeutschen Vorwende-Menschen zuweilen auch einmal in Kontaktnähe zu echt lebenden Italienern brachten – so entlang der Streckenverläufe der alljährlich im Frühling stattfindenden „Internationalen Radfernfahrt für den Frieden“, an der sich die von Starreporter Heinz Florian Oertel ihrer traditionell blauen Trikots wegen „Azzurris“ getauften italienischen Pedalritter regelmäßig und oft erfolgreich beteiligten. Ach, wie gern hätte der mit seinem blauen Pionierhalstuch winkende Zaungast während der Ferien im Gegenbesuch Italien von Venedig bis Palermo durchradelt. Und wenn er die ganzen Alpen ‘rauf zu sein Rad geschoben hätte! Aber wie es erst einmal heil über die Mauer kriegen?
Italien-Reisekarten führte der Volksbuchhandel nicht. Aber doch hin und wieder Literatur-Klassiker aus dem Lande jenseits der Alpen, antike und moderne, von Seneca und Ovid bis Alberto Moravia und Italo Calvino. Zur nur unterm Ladentisch gehandelten „Bückware“ zählten die – oft von so bedeutenden DDR-Grafikern wie Max Schwimmer oder Kurt Klemke liebevoll illustrierten – Titel allemal. Ovids erstmals Anfang der sechziger Jahre erschienene „Liebeskunst“, die nach dem damaligen Verständnis der DDR-Kulturhüter hart an der Gürtellinie zur Pornographie einzustufen war, durfte sogar nur in einer für DDR-Verhältnisse sündhaft teueren akademischen Subskriptions-Edition „für Studienzwecke“ herausgegeben werden. Selbst hinsichtlich Boccaccios Dekameron galt den Hohenpriestern und Schriftgelehrten lange Zeit das ostdeutsche Volk als nicht reif genug, dass man das Buch hätte ins Schaufenster legen können.
Gut zwanzig Jahre später hingegen, 1985, überraschte man, ja schockierte nachgerade die längst an Wartekummer gewöhnte Leserschaft damit, dass Umberto Ecos „Der Name der Rose“ schon zwei Jahre nach Erscheinen der deutschen Übersetzung in der Bundesrepublik plötzlich in den Buchhandlungen Leipzigs, Rostocks und Eisenachs zu erstehen beziehungsweise zu erbücken war – im vorausschauenden Titelverzeichnis des für Auslandsliteratur zuständigen Ostberliner Verlags Volk und Welt fürs betreffende Jahr überhaupt nicht angekündigt und auf einer Art graubraunem Konsumtütenpapier aus irgendwelchen Staatsreserven gedruckt. Aber immerhin gedruckt. – Übrigens sollte Ecos folgender großer Roman einer der letzten zeitgenössischen westeuropäischen Titel überhaupt sein, der in der DDR verlegt wurde: kurz bevor ihre Uhr ablief, erschien 1990 „Das Foucaultsche Pendel“.
Der italienische Klassiker der Nachkriegszeit per se, Guareschis „Don Camillo und Peppone“, hatte bis zum DDR-Ladenschluß allerdings keine Chance, gedruckt zu werden, auf welchem Papier auch immer. Schlimmer noch: er stand 40 Jahre lang sogar auf dem Index der für die Einfuhr als Postgut oder als Mitbringsel verbotenen Druckschriften. Wurde das Buch aus Geschenksendungen mit Bundespostbriefmarke anfangs kurzerhand konfisziert, schickte es der DDR-Zoll später infolge des Inkrafttretens der KSZE-Vereinbarungen von Helsinki wenigstens nach Westdeutschland zurück – allerdings mit dem kompletten Paket, auf dem eine in Zollgrün gedruckte Mitteilung fein säuberlich aber nicht etwa den Titel, sondern nur die Index-Nummer des inkriminierten „Inhalts aus der Liste der verbotenen Gegenstände“ vermerkte. Da sollte der Absender, der womöglich mehrere Bücher zu transferieren gewagt hatte, sich doch nun einmal selbst Gedanken machen, was denn wohl darunter sich nicht schickte, in die DDR geschickt zu werden.
Die Ablehnung von Guareschis Romanhumoreske durch die Kultur- und Kunstwächter der SED um den Chefideologen Kurt Hager wurde allen Ernstes damit begründet, der Autor diffamiere das hehre Kämpfertum aller aufrechten Kommunisten der Welt gegen kapitalistische und weltanschauliche Rückständigkeit. Das „Taschenbuch Fremdsprachige Schriftsteller“ des renommierten Leipziger Bibliographischen Instituts formulierte da in der 4. Auflage 1982 seine Kritik schon etwas freundlicher, wenn auch immer noch albern genug. Die „versöhnlich-neutralistische Darstellung“ der „täglichen Zwistigkeiten zwischen dem Pfarrer und dem kommunistischen Bürgermeister“ werde „allerdings den eigentlichen gesellschaftlichen Problemen Italiens nicht gerecht“, war hier als Resümee zu lesen.
Italien war für den DDR-Bürger immer irgendwo in der Nähe, aber nie richtig greifbar, begreifbar. Ausgenommen medaillenverdächtige Leistungssportler, ein paar wenige Künstler wie Willi Sitte und Werner Tübke und noch seltener (und erst in späten DDR-Jahren) Literatinnen und Literaten, so Waldtraut Lewin, Christine Wolter oder auch Friedrich Dieckmann. Lewins in den achtziger Jahren in Ostberlin erschienene „Römische Trilogie“ und ihr nachfolgender großer „Federico“-Roman zählen zum Sensibelsten und zugleich Handfest-Kunstvollsten, was in den letzten zwei Jahrzehnten aus einer deutschen Dichterwerkstatt über italienische Vergangenheit und Gegenwart geschrieben wurde, und Dieckmanns umfassende kunstwissenschaftliche Collage „Richard Wagner in Venedig“, 1983 bei Reclam in Leipzig in einer Taschenbuchauflage publiziert, führt vor Augen, wie DDR-Autoren ihre meist nur kurz befristeten Auslandsaufenthalte im Westen in unglaubliche kreative Intensität umzusetzen wußten. Dabei hätten solche Italien-Stippvisiten, mit keinerlei Garantie für ein Arrivederci, doch eher ein lähmender Kunst- und Kulturschock sein können.
Am nächsten für jedermann war Italien im Kino um die Ecke, manchmal. Als Viscontis „Rocco und seine Brüder“ im September 1962 seine DDR-Premiere hatte, ging vielen das ferne Land erstmals richtig unter die Haut, so wie zwei Jahrzehnte später noch einmal Bertoluccis „1900“. Davor und dazwischen gab es auch im staatlichen Progress-Filmverleih zuweilen Auftritte von Caterina Valente, Gina Lollobrigida und Marcello Mastroianni, je nach politischer und moralischer Botmäßigkeit und abhängig von der Devisensituation. Und dann war ja auch noch das Fernsehen. Adlershof strahlte schon mal eine Reportage über „Die rote Toscana“ aus, aber die Westsender berichteten lang und breit über die Filmfestivals in Venedig, zeigten, wie sich Schlager-, Film- und Opernstars einrichteten und kleideten, den Alltag der Weinbauern und Pizzabäcker und den Teutonengrill an der Adria. Und Werbung. Wie man – presto – dolce vita aus Keller und Kühltruhe unter bundesdeutsche Dächer zaubern kann. Eines Tages sogar in Farbe für jenen Ostzuschauer, der sich mittels westfamiliärer Devisenspende im Intershop oder über den Genex-Versandhandel einen PAL-tauglichen Fernseher ergattern konnte. – Aber man saß doch nur vor der Scheibe. Eigentlich hinter ihr: kam nicht ‘raus aus dem Staatsterrarium DDR. Und da keimte und wuchs sie nun, diese frustige Sehnsucht. Einmal selbst durch Rom gehen, einmal im Schatten des Schiefen Turms von Pisa stehen, Venedig sehen und sterben. Aber vorher erst noch an der Adria in der Sonne liegen, mit Nivea und nicht mit Florena eingecremt.
Wer eisern sparte, konnte sich Adria-Ersatz am Plattensee in Ungarn oder am Schwarzen Meer in Bulgarien oder Rumänien leisten. Von dort wurden für ein paar kurze Sommerwochen auch die Trauben- und Melonenesser in der DDR versorgt (oh, wie verschlang man als Kind Murillos gleichnamiges Gemälde aus einem Album alter spanischer Meister). Eine Zeit lang, vor allem in den sechziger Jahren, gab es für sehr zahlungskräftige DDR-Bürger wie etwa Handwerker und Intelligenzler mit Sonderbesoldungsverträgen sowie für verdiente Produktions-Aktivisten Kreuzfahrten übers Mittelmeer auf gewerkschaftseigenen Ferienschiffen (ohne Hafenanfahrt im NATO-Land Italien!), und gelegentlich wurden sogar einige Reisebüro-Hotelbetten an der jugoslawischen Adriaküste angeboten.
Der gewöhnliche 800-Mark-Monatsdurchschnittsverdienst-Sterbliche hingegen schlüpfte, wenn ihn das Italienfieber überfiel, in seine Römersandalen, griff seufzend tief in die Tasche, holte sich im Delikat-Geschäft am Ostberliner Fernsehturm (zum längst offiziellen „Schwindelkurs“ eins zu sieben) für zehn DDR-Mark ein Gläschen sauer eingelegte Oliven und für einen „Goethe“, der den Zwanzigmarkschein zierte, eine Flasche in Neubrandenburg abgefüllten halbtrockenen italienischen Weißwein und fuhr mit dem Trabi auf die Autobahn Richtung Süden. Bis zum „Waldbad Adria“ direkt an der Abfahrt Dessau-Ost. Hier konnte er unter den Schornsteinwolken des Braunkohlekraftwerks Vockerode von Mandolinen und Mondschein träumen.
Besagte Sandalen, im DDR-Volksmund schlicht Römerlatschen genannt, waren mitnichten italienische Importware, sondern kamen aus Meißen und aus Weißenfels bei Leipzig. Sie zählten und zählen heute noch, trotz Birkenstock- und Reno-Konkurrenz, zur Sommer-Standardfußbegleitung des bodenständigen Ostelbiers, während das 35 Jahre lang in Zwickau montierte Trabant-Vollplastauto mittlerweile lediglich noch Ostalgie-Objekt ist. Ein einziges Mal sollte es ihm allerdings vor Einstellung der Produktion tatsächlich doch noch vergönnt gewesen sein, auch in Italien furore zu machen: Als Hauptdarsteller in der gesamtdeutschen Nachwende-Filmklamotte „Go Trabi go“ – gelenkt von wem wohl? Von einem Sachsen natürlich.
Wer als eher luxusbewußter Autofahrer etwas auf sich hielt in der DDR und entsprechend flüssig war, um nicht nur den Kaufpreis in Höhe von mindestens drei Durchschnitts-Jahreseinkommen, sondern auch die zu erwartenden Bußgeldbescheide wegen permanenter Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Autobahn (100 Stundenkilometer Spitze waren erlaubt) begleichen zu können, stieg Anfang der siebziger Jahre auf den Fiat Polski um, der durch die Importeure des DDR-Außenhandels bald um die sowjetische Fiat-Variante Shiguli ergänzt wurde. Die (später in Lada umgetaufte) russische Version des in Italien ausgelaufenen Originals Fiat 124 wurde von den Arbeitern eines neu errichteten und nach dem italienischen Kommunistenführer Togliatti benannten Automobilwerkes an der Wolga zusammengebaut und war bis zum Ende der DDR einer der begehrtesten fahrbaren Untersätze der Besserverdienenden.
Polski Fiat, Shiguli und Lada zählten zu den ersten, aber auch den einzigen Gebrauchsgütern, die den Ostdeutschen in nennenswerten (wenn auch nur mittelbaren) engeren Berührungskontakt mit italienischer Alltagskultur brachten. Per Zufall war womöglich auch einmal eine Schmuckschale aus Murano-Glas im staatlichen Kunstgewerbegeschäft zu haben und ein Paar kaum bezahlbare Schuhe oder eine Luxus-Krawatte aus Mailand im Exquisit-Handel. Design in beziehungsweise aus Italien war ansonsten so wenig ein Thema in der DDR, wie DDR-Design in Italien. Auch nicht für die in Ostberlin, Halle oder Heiligendamm ausgebildeten und in der volkseigenen Industrie arbeitenden Designer, jedenfalls kein sonderlich diskutables. Woher auch. Bis weit in die achtziger Jahre hinein gab es dazu in der DDR weder entsprechende nennenswerte Fachpublikationen noch gar Ausstellungen, abgesehen von der Möglichkeit des Besuchs italienischer Firmenpräsentationen auf den Leipziger Messen. Dieses Schaufenster nutzten DDR-Designer selbstverständlich. Das gewöhnliche Messevolk aber zog es vor, sich unter den Firmenzeichen bundesdeutscher Aussteller die Beine in den Bauch zu stehen.
Wenn Italien selbst für Künstler und Literaten der DDR ein Ausnahme-Reiseziel war, erreichbar in der Regel sowieso nur mit einem von ihren Berufsverbänden beantragten „Dienstvisum“, so lag für hiesige läppische Produktgestalter das Land jenseits der Alpen völlig außerhalb erreichbarer Begehrlichkeiten. Maler, Bildhauer, Dichter, Regisseure, Musiker und Sänger galten den Dienstvisum-Erteilern gelegentlich als gern zitierte „Kulturbotschafter des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden“. Auf den Gedanken, diesen hehren Maßstab auch Vertretern des DDR-Designerberufsstandes anzulegen, kam man überhaupt nicht – was freilich nichts über die einstmaligen wahren Qualitäten ostdeutscher Gestalter aussagt, vielmehr etwas über das Gesichtsfeld der kultur- (und reise-) politischen Entscheidungsgewaltigen in Ostberlin. Ein typischer authentischer Fall: 1964 wurde die geachtete ostdeutsche Keramikerin und Industrieformgestalterin Margarete Jahny in Faenza mit einer ihrer dort eingereichten Arbeiten zur Ersten Keramik-Preisträgerin gekürt, durfte jedoch nicht einmal zur Entgegennahme der Trophäe hinfahren. Die wurde ihr später von einem Vertreter des DDR-Kulturministeriums zu Hause „nachgereicht“.
Als eher kurios und zugleich unter merkantilem Aspekt bemerkenswert zu bezeichnen ist hingegen folgende, sich Jahrzehnte später ereignende Episode mit in Italien erfolgreichem DDR-Design: 1985 entwerfen die Ostberliner Designstudenten Albrecht Ecke und Reinhart Panier eine „für experimentierfreudige Käufer interessante einfache und billige“ Bausatz-Leuchte, die unter anderem in der Fachzeitschrift form + zweck vorgestellt wird und mit der sie den 1. Preis eines Leuchten-Innovationswettbewerbes des DDR-Großproduzenten NARVA gewinnen. Die zunächst auch ernsthaft erwägte Produktion von CLIP + CLAP, so heißt das Modell, kommt aber dann doch nicht zustande. Dreizehn Jahre später, 1998, besucht Albrecht Ecke, mittlerweile einer der erfolgreichsten Designer in den neuen Bundesländern, die Frankfurter Tendence-Messe und bleibt wie angewurzelt am Stand der Firma SLAMP aus Rom stehen. Dort strahlt ihn seine CLIP + CLAP an, originalgetreu bis ins letzte Detail. Ecke und Pannier machen umgehend ihre Urheberrechte geltend – und bekommen sie nach Prüfung durch die SLAMP-Anwälte nicht nur anstandslos zugesprochen, sondern von der (zunächst mindestens ebenso wie die Autoren konsternierten) Produktmanagerin Etta Flatow obendrein Aufträge für zwei neue Leuchtenentwürfe, die nun im Jahr 2000 in Serie gehen.
Einer der geistigen Väter Albrecht Eckes und Vorreiter funktional und sozial engagierten Serien-Designs in der DDR der sechziger bis achtziger Jahre, der die Berufsbezeichnung „Designer“ bis heute verpönende Chemnitzer Formgestalter Clauss Dietel, weist in seiner Biographie neben vielen sozialistischen Ländern, der Bundesrepublik Deutschland sowie Dänemark und Finnland auch Italien als Reiseerfahrung aus, ermöglicht nicht zuletzt durch seine langjährige Tätigkeit als hoher Funktionär des Verbandes Bildender Künstler der DDR. Daß er jedoch aus Italien epochale Anstöße für sein Schaffen mitgebracht habe, verneint heute der Mit-Schöpfer des Eisenacher Pkw Wartburg 353, zahlreicher Motorräder, -roller und Mokicks, aber neben anderem auch von Rundfunkgeräten und Schreibmaschinen. Viel mehr, so betont er, konnte er sich an den Traditionen und Innovationen eines weniger elitären und dafür stärker demokratisch und sozial orientieren skandinavischen Designs orientieren.
Nordische Formkonzepte und -lösungen waren in der Tat den DDR-Gestaltern stets sehr viel näher, „lagen“ ihnen mehr als mediterrane, italienische. Das hatte nicht nur mit einer geringeren geographischen Entfernung zu den unmittelbaren Nachbarn, den Ostsee-Mitanrainern Dänemark, Schweden und Finnland zu tun. Dass es besonders zu Finnland und Schweden häufigere fachliche Kontakte gab, ja hier mitunter sogar zu gemeinsamen Architektur- und Designprojekten kam, die vor allem den öffentlichen Raum betrafen, hatte auch einen ausschlaggebenden politischen Grund: Diese beiden Staaten waren politisch neutral, keine NATO-Mitglieder wie Italien, und Finnland hatte sich zudem als erster westlicher Staat über die berüchtigte bundesdeutsche Hallstein-Doktrin hinweggesetzt und die DDR sowie die BRD mit einem diplomatischen Kunstgriff gleichzeitig als souveräne Staaten quasi-anerkannt. Nicht zu vergessen, dass Helsinki auch den Gastgeberpart übernahm für die Unterzeichnung der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die auch der weltweiten diplomatischen Anerkennung der DDR und 1973 der Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO die Türen öffnete.
Zugleich öffnete die Schlußakte von Helsinki endlich auch zunehmend Fenster, die dem DDR-Bürger den einen oder anderen Ausblick auf zurückliegende und zeitgenössische Kulturen entfernterer europäischer Nachbarn gestatteten. So kam es auch endlich im Jahr 1986 zur ersten (und ungeahnt gleichzeitig letzten) italienischen Designaussstellung überhaupt in der DDR. Am Ostberliner Fernsehturm und anschließend in einer Erfurter Galerie wurde eine Auswahl von Preisträger-Produkten des „Compasso d’oro“ aus den Jahren 1954 bis 1981 gezeigt. Die Begeisterung des Lauf- wie des Fachpublikums hielt sich allerdings in Grenzen.
„Die Ausstellung gab an Hand von Originalen einen Überblick über die in diesem Zeitraum ausgezeichneten Produkte“, resümierte der Rezensent Herbert Pohl in Heft 2/1987 der DDR-Designfachzeitschrift form + zweck, jedoch „die Intentionen und Kriterien, die irgendwann einmal der Auswahl zur Preisverleihung zugrunde lagen, blieben im Dunkeln“, bemängelte er. Eben, weil „Ausstellungen dieser Art“ einen Beitrag leisten sollten „für die allgemeine Entwicklung von Qualitätsvorstellungen und Qualitätsforderungen in der DDR, des Wissens über ein Heute in der Welt industriell und wirtschaftlich bereits realisiertes technisches und ästhetisches Niveau“. Pohl, selbst Architekt und Designer, fragte: „Wer weiß genaueres über die engen Bindungen (in Italien, d. V.) zwischen Architektur, bildender Kunst und Design? Bindungen, die sich bis heute häufig in der Personalunion ihrer Schöpfer ausdrücken. Wer kennt die strukturelle Entwicklung der Industrie und die Rolle des Handwerks in Italien.“
Bemerkenswert, dass trotz (oder gerade wegen?) 40 Jahren Wahrnehmungsvakuums in Ostdeutschland hinsichtlich italienischer Designentwicklungen so punktgenau der Finger auf die Wunden eines Ausstellungskonzeptes gelegt wurde, das für eine per se interessierte und wenigstens halbwegs vorgebildete Besucherminderheit zwar einen Überblick bot, aber keine komplexen Einblicke in Werden und Haltung italienischer Produktkultur für eine bislang völlig uninformierte, Italien allein als Mutterland römischen, barocken oder klassizistischen Kulturerbes „kennende“ Mehrheit der DDR-Bürger.
Ein Wunder ist es freilich nicht, dass gerade in den achtziger Jahren unter Architekten und Designern der DDR italienische Entwurfskultur erstmals auf größere Aufmerksamkeit stieß. An der auf der Apenninhalbinsel ausgelösten Postmoderne schieden sich auch hier die Geister, selbst wenn das Beurteilen der Originalbauwerke und -gegenstände in Italien und anderswo in Westeuropa oder gar in den USA verwehrt war. Der eine oder andere Schlagschatten der aufgehenden postmodernen Sonne hinter den Alpen reichte immerhin schon auch bis Budapest.
In der DDR allerdings galt auch hinsichtlich solcher ästhetischen Grenzüberschreitung offiziell das allgemeine SED-Diktat: „Keine Experimente!“ Als form + zweck in Heft 5/1987 den (sehr gemäßigten) Versuch einer Ostberliner Projektanten- und Architektengruppe um Wolf-Rüdiger Eisentraut und Michael Kny publizieren wollte, seriell hergestellte Plattenbausegmente mit freien Architekturformen am Hauptpostgebäude der Satellitenstadt Berlin-Marzahn zu verbinden, fiel nicht nur die leichtfertig gewählte Headline „Post modern“ dem Zensurstift zum Opfer, sondern mußten die bereits in die Druckerei gelieferten Manuskripte „in eine sachlichere Form“ umgeschrieben werden. Und eineinhalb Jahre darauf war die Redaktion dazu verdonnert, unter der Überschrift „Anspruch und Rationalität“ in Heft 2/1989 den oktroyierten Artikel eines Haus- „Experten“ des staatlichen Amtes für industrielle Formgestaltung zu veröffentlichen, der „einige der Darlegungen der Architekten und Projektanten in Heft 5/1987 im Zusammenhang mit bau-ästhetischen Erscheinungsbildern des Post- und des S-Bahnhofsgebäudes nach der Fertigstellung kritischen Betrachtungen“ unterzog.
Deutscher, sprich auch nachhaltig-verbissener als in der Deutschen Demokratischen Republik konnte eine Abrechnung mit vermeintlich antifunktionalistischen italienischen Architektur- und Design-Exzessen nicht sein, wenn es zutrifft, dass „Deutschsein nicht das Resultat eines ,Bewusstseins an sich’, sondern nur das Ergebnis eines ,Bewusstseins gegen’ ist“, wie Roberto Giardina in seiner 1994 erschienenen famosen „Anleitung, die Deutschen zu lieben“ feststellt. Die Ostdeutschen lieben inzwischen aber auch schon italienisches Design. Und manche wissen sogar bereits, dass man in Rom einen Cafe bestellt, wenn man einen Espresso schlürfen will. Und es ist für sie längst selbstverständlich geworden, dass der Espresso im Italienischen Dörfchen aus einer italienischen Maschine in italienisches Porzellan läuft.
[/paycontent]
(Katalogbeitrag Ausstellung „4:3 / 50 Jahre italienisches & deutsches Design“ Bundeskunsthalle Bonn 2000)