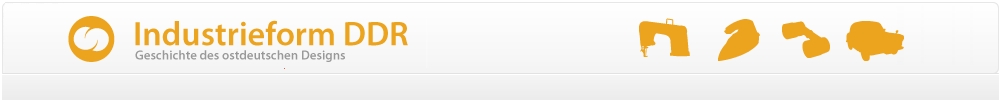Was in Europa die Spanier und die Holländer seit langem vormachen, will in Deutschland nur ausnahmsweise gelingen: den Kommunen ein stimmiges, kommunikationsfreundliches Ambiente zu verleihen, das auch jenseits der Jahrtausendschwelle Bestand haben wird.
Von Günter Höhne
Wer sommers im lieblichen mainfränkischen Dettelbach sich beim Bocksbeutel über Gott und die Welt austauschen will, wer unter Leute kommen möchte, der trifft sich heute wie eh und je in der Stadtmitte im Schatten eines Weinausschanks, unter freiem Himmel zu Füßen einer hohen Kirchbergmauer. Man sitzt auf schlichten Holzbänken an langen Tischen, und wenn die Gespräche und das Klingen der Gläser dann und wann, wie auf ein geheimes Signal hin, unvermittelt abebben, ist das Plätschern eines Brunnenstrahls zu hören. Gleich nebenan führt die Treppe hinauf zur Stadtpfarrkirche. Wo die Stufen ansetzen, belagert ein über dreihundert Jahre alter Pranger aus Sandstein den Zugang.
Schanktische, Brunnen, Schandpfahl: mittelalterliche Grundausstattungen einer „kommunikativen Stadtmöblierung“ oder von „Urban Design“, wie wir das heute nennen. Sie funktionieren bis dato, vom Pranger abgesehen. Dessen Aufgabe im Stadtbild haben in unserer Gegenwart Zeitungskioske mit ihren Aufstellern, auch Wahlplakate von Zeit zu Zeit sowie an alten und neuen Gemäuern die Gesellschaft geißelnde Graffiti-Parolen übernommen.
Im preußischen Berlin sagt man letzteren jetzt endlich den Kampf an. Das dafür erforderliche Geld schöpfen die pfiffigen Hauptstadtpolitiker womöglich aus den trockengelegten Brunnen in Parks und auf öffentlichen Plätzen. Ein Paradoxon? Mitnichten, denn die bereits zwei Sommer lang abgestellten – bis auf einige aus Privatspenden gespeisten – Wasserspender sollen Haushaltmittel sparen beziehungsweise umleiten helfen. Man ist in den Rathäusern nicht mehr flüssig, sprudelnde Brunnen sind hinausgeworfenes Geld. Nun wird freilich auch keines mehr von den Touristen in die Bassins, die leeren, hineingeworfen. Stattdessen Müll. Und die jetzt trockenen Fußes zugänglichen Gebrauchskunstwerke bieten neue Betätigungsfelder – für Sprayer. [paycontent]
Wasserspender für die Allgemeinheit sind seit alters her Kommunikationszentren, besonders anziehende Treffpunkte im urbanen Raum, Lebenszeichen für die Kultur einer Gemeinde. Es gibt Orte wie Nürnberg, wo die Geschichte und Geschichten der Stadt sich in unzähligen Brunnen widerspiegeln. Auch in den letzten Jahrzehnten sind neue hinzugekommen. In der Bundeshauptstadt hingegen läßt man den historischen Bestand nachlässig verrotten, und keiner empört sich.
Es ist schon seltsam, wie Zeichen von Alltagskultur im öffentlichen Raum wahrgenommen werden und warum manche scheinbar gar nicht. Das Rezeptionsverhalten der Menschen erweist sich auch hier als eigenwillig. Ungeachtet dessen hoffen heutige Stadtplaner und Architekten, Kommunikations- und Produktdesigner immer wieder darauf, daß ihre Angebote zur gestalterischen Ordnung und ästhetischen Bereicherung in den Kommunen fruchten, von den Politikern und den Bürgern angenommen würden. Aber was an der Volkacher Mainschleife, in Nürnberg oder im Chiemgau historisch gewachsen ist, und zwar nicht nur in gestaltgewordener regionaler Identität, sondern zudem auch an aktiver Identifizierung, an selbstverständlicher Wahr-Nehmung im wörtlichen Sinne, wird dem Bewohner einer Multimetropole wie Berlin als Feriengast andernorts wohl gefallen, im eigenen Kiez daheim aber eigentlich befremdlich und auch durchaus verzichtbar erscheinen.
Und vielleicht ist das auch überhaupt unzeitgemäß: mit einem bewahrenden oder gar in die Zukunft weisenden Gestaltungsprogramm einer Megastadt wie Berlin Liebenswürdigkeit, Bürgerfreundlichkeit zu injizieren? Lebt der neue, junge Citoyen des ausgehenden 20. Jahrhunderts nicht gerade deshalb im städtischen Ballungsraum, weil ihm hier die Anonymität unendlicher Straßenzüge und aufgetürmter Massenwohnviertel auch selbst weitgehend anonymen Unterschlupf garantiert, ihn vor Vereinnahmung durch Nachbarn, Traditions- und Schützenvereine schützt? Ist das von ihm bewußt bevorzugte Image der Großstadt nicht eben jenes des Imaginären, abseits der properen Königsalleen, Parks und repräsentativen Plätze, unberührt von den Inszenierungen ehrgeiziger Stadtplaner und Kommunaldesigner?
In Barcelona, wo seit Anfang der achtziger Jahre „die Wiedereroberung des öffentlichen Raums“ langfristiges stadtpolitisches und -gestalterisches Komplexprogramm ist, geht das aber offensichtlich gut zusammen – modernes Urban Design und individuelle Lebensqualität. Tiefgreifende verkehrsberuhigende Maßnahmen und mehr als 150 neue kommunale, von den Einwohnern und Touristen begeistert vereinnahmte Plätze und Parkanlagen prägen eine Stadtumgestaltung, welche ohne die bei derartigen Großprojekten üblichen Installationsorgien charakterlos-serieller Ausstattungselemente auskommt. Stattdessen wird umsichtige Sorgfalt auf das Initiieren, Diskutieren und praktische Umsetzen von Ideenwettbewerben der angewandten Kunst sowie des Kommunikations- und Public-Designs verwendet. Immer mit federführend dabei ist das hier ansässige katalanische Designzentrum, das sich nicht nur in puncto Stadtkultur längst einen auch international beachteten Ruf erworben hat.
Während in Barcelonas Stadtbezirken derzeit eine (im großen und ganzen behutsame) Revision und Reorganisation der urbanen Umweltstruktur vonstatten geht, wird hingegen im niederländischen Almere „nur“ kontinuierlich etwas fortgesetzt, was in ganz Holland im Grunde genommen seit den Manifestationen der De-Stijl-Bewegung Tradition ist, aber zu immer wieder hinreißenden Ergebnissen führt: eine komplexe Inszenierung kommunikativer, demokratischer Alltagsästhetik in rational-funktionaler wie zugleich phantasievoll-heiterer Qualität bis ins letzte Detail. Almere, 28 Kilometer östlich vor Amsterdam gelegen, ist sozusagen ein Retorte-Kind des modernen Städtebaus, 1970 in die Wiege gelegt auf dem einstigen Grund der zurückgedrängten Zuijdersee, des heutigen Flevoland. Mittlerweile hat die immer noch wachsende neue Wohn- und Geschäftsstadt die Einhunderttausend-Einwohnergrenze überschritten, ohne dabei das erwartungsgemäße Bild einer städtischen Massensiedlung angenommen zu haben. Jeder der momentan drei Stadtteile verkörpert einen eigenen Charakter, bietet unterschiedliche Wohnumgebungen und Wohnungstypen, darunter mit experimentellem Witz korrespondierende Modellprojekte wie „De Fantasie“ und „De Realiteit“. Man hat von den schlimmen Satellitenstadt-Ausrutschern Amsterdams gelernt.
Neben der baulich wie farblich ungemein abwechslungsreichen Architektur halbkreis- und speichenförmig angelegter Reihenhäuser, Mehrgeschosser und Stadtvillen faszinieren besonders die strahlende Eleganz der öffentlichen Gebäude, deren Umfeld sowie ein Interieur, das dem auf dem Hauptbahnhof Ankommenden, dem Besucher des Rathauses wie dem Patienten im FlevoKrankenhaus freundlich-kultiviertes Entgegenkommen signalisiert. Keine Frage: Hier waren Architekten und keine Bauzeichner am Werk, Designer und keine nach eigenem Gusto Stadtmöbel-Dutzendware einkaufenden Stadtangestellten.
Schon von weitem ihre Funktion originell bildhaft signalisierende Fahrradständer und komfortable Wartestationen an den vollständig separat angelegen Autobus-Trassen, eine den Wohngebieten und unterschiedlichen öffentlichen Bereichen individuell zugeordnete Außenbeleuchtung, Orientierungshilfen und Informationspunkte, die diesen Namen verdienen – alles ist wie von leichter, glücklicher Hand entworfen, nicht bemüht „aus einem Guß“ und doch insgesamt ortstypisch, identitätsstiftend. Es sind dies die feinen Lachfalten im Gesicht der Stadt, wie wir sie auch am altehrwürdigen Amsterdam, an Leiden oder Tilburg so schätzen.
Auf die Gestaltung des kommunalen Raums, des Verkehrens und Wohlbefindens in ihm, wird in den Niederlanden traditionell bedachtsames Augenmerk bis ins Detail verwendet. Man achte auf den ästhetischen Einfallsreichtum bei solch profanen Objekten wie Pollern, auf die kunstvoll gefügten Straßenpflaster aus Klinkersteinen, auf Ufer- und Brückengeländer. Das Land ist dem Meer in harter, generationenübergreifender Arbeit abgerungen, den Holländern von der Natur wenig „geschenkt“ worden. Es scheint allgemeiner Konsens zu sein, dieses gemeinsam erworbene Lebensumfeld sehr bewußt zu kultivieren und effektiv zu nutzen. Wobei dieses Effizienzverständnis offenbar Genußfähigkeit einschließt. Eine dem Deutschen eher fremde mentale Kombination.
Hollands Designer zählen zur Weltelite, und keiner, sei er noch so erfolgreich im internationalen Geschäft, der nicht die Einmischung in die „inneren Angelegenheiten“ der Kommune und des Landes als nächstliegende Aufgabe betrachtete. Das wird ihm in der Regel auch nicht schwergemacht. Die öffentliche Hand und große Dienstleistungsunternehmen wie Bahn oder Post zählen seit jeher zu den kulturell und künstlerisch aufgeschlossensten Design- Auftraggebern des Landes. Als man in Deutschlands Amtsstuben gerade mal anfing, „Corporate Identity“ zu buchstabieren, hatten große öffentliche Bereiche in Holland längst eine auch äußerlich veränderte, moderne Identität erhalten, sich Corporate Culture zugelegt. Ein neues komplexes Erscheinungsbild der Staatsbetriebe Post und Eisenbahn zum Beispiel, hier vom Kundenschalter über die Farbgebung für die verschiedenen Service-Bereiche bis hin zur Briefmarke, da von der Bahnhofsarchitektur und dem Fahrzeugdesign bis zum Informationssystem, wurde schon in den siebziger Jahren in Angriff genommen und bis in die achtziger komplett durchgesetzt. Bis heute sind die sonnengelben Regionalbahn-Blitze und die signalroten Briefkästen auf ihren blauen Stahlrohrfüßen außerhalb der Tulpensaison mit die schönsten Farbtupfer im grauen Alltag eines übers Land ziehenden Nordwest-Sturmtiefs.
Die höchste Repräsentanz des Staates, Königin Beatrix persönlich, schaut gelegentlich den Designern gern über die Schulter, wie schon Anfang der achtziger Jahre, als sich der damals noch sehr junge Industrie(!)-Produktgestalter Bruno Ninaber van Eyben als Gewinner des Wettbewerbs um die Gestaltung neuer niederländischer Geldstücke an deren Ausarbeitung machte. Er, längst einer der weit über Hollands Deiche hinaus berühmten niederländischen Designer-Stars und übrigens auch Schöpfer besagter Postbriefkästen, schwärmt heute noch von der Sachkunde und Toleranz der wahrscheinlich ersten Königin der Welt, die ihr obligatorisches Konterfeiprofil auf der Münzenrückseite ohne den geringsten Protest ungewöhnlich weitgehend graphisch beschneiden ließ.
Aber zurück zum Urban Design und wieder deutschen Realitäten auf der Spur. Rotterdam war die Stadt mit Europas erster gestalteter City- Fußgängerzone, noch in den fünfziger Jahren, beim Wiederaufbau der von den Deutschen bombardierten Stadt, den Flaneuren übergeben, wenig später machten sich derartige autofreie Einkaufs- und Schlemmerparadiese auch in Westdeutschland breit und breiter. An den Ausstattungen für diese teils bedachten, teils unbedachten (ha, welch Doppelsinn!) städtischen Neuerungen verdiente sich vielleicht ein halbes Dutzend Hersteller goldene Nasen. Da brachte die modulare Großserie das schnelle Geld, und auch den Stadtvätern war sie recht, weil erstens vermeintlich preiswerter als ein originäres lokales Stadtmöbelsystem und zweitens so schön unkompliziert vor- und aufstellbar anhand der reich bebilderten Firmenkataloge.
Aber dann fühlte sich mit einem Mal der Regensburger Stadtkämmerer in der Emdener Fußgängerzone wie zuhause und umgekehrt (die Beispiele sind rein hypothetisch gewählt, ebenso beliebig austauschbar wie die allenthalben mit Glaskugeln bestückten Kandelaber, die Handvoll von Sitzbankkonstruktionen und Abfallbehältern, die Poller, Betonpflanzkübel und -hochbeete. Das versuchten nun ab der 80er Jahre „Public Design“-Messen in Frankfurt am Main zu korrigieren, auf Neues, Besseres zu orientieren. Zu spät und vergebens aber. Mangels Masse in den Stadtkassen und des auf so fatale Weise inzwischen erreichten Sättigungsgrades öffentlicher Raumausstattungen blieben die Designer und Hersteller alternativer Angebote ohne nennenswerte Absatzaussichten, verabschiedete sich 1989 die dritte und letzte „Public Design“ sang- und klanglos. Seither praktizieren die Kommunen, wenn überhaupt, in Sachen Stadtkultur weiterhin auf gut Glück, je nach Kenntnisstand der Dinge sowie Pegelstand im Stadtsäckel. Einmal noch gab es einen Aufschwung: nach dem Fall der Mauer in den neuen Bundesländern. Selbstredend aber wieder ausschließlich für die eloquenten Massenartikelanbieter, die nun wenigstens ihre Lagerbestände staatlich subventioniert unter die Leute bringen konnten.
Allein die neue Bundeshaupstadt Berlin schien sich zu dieser Zeit einen innovativen Ruck geben zu wollen. Da war von Haushaltslöchern weit und breit offenbar noch nichts zu sehen, stattdessen die Aussicht auf „Olympiastadt 2000“ voll im Visier. Erik Spiekermanns Gestaltungstelier MetaDesign plus, das bereits den schwierigen Senats-Wettbewerb um ein modernisiertes grafisches Erscheinungsbild Berlins für sich entscheiden konnte, wurde nun damit beauftragt, auch das Corporate Design der öffentlichen Verkehrsbetriebe, der BVG, komplex und komplett zu überarbeiten. Als Leitbild für eine tiefgreifende Erneuerung des hauptstädtischen Stadtbildes bis zur Jahrtausendwende sollte es fungieren.
Als die in einem intellektuellen und materiellen Parforceritt innerhalb von nur gut zwei Jahren bewältigte Designaufgabe abgearbeitet war, fand sie weit über die Stadtgrenzen hinaus großen Beifall und mehrere gewichtige internationale Designpreisanerkennungen. In Berlin aber wird mit der Umsetzung der Ausstattungsensembles (das Informationsträgersystem „Arcus“ stammt vom kooperierenden Berliner Entwurfsbüro Ecke:Design) und des farblich-gestalterischen sowie grafischen, auf der neuen Schriften- und Zeichenfamilie „Transit“ basierenden Konzeptes nur gekleckert, seit „Berlin 2000“ ad acta gelegt ist. Im nunmehr radikalen, um nicht zu sagen rabiaten Sparprogramm der Hauptstadtregierung werden neue Berechnungen zur Grundlage des im öffentlichen Raum Nötigen und Möglichen angestellt, von den überflüssigen Brunnen bis zur „eigentlich korrekten Abschreibungsfrist“ von 200 Jahren der Berliner U-Bahnhöfe.
Eine der neu gesetzten Präferenzen lautet nun: vollständiges Einführen des neuen Erscheinungsbildes, das einmal „das Public Design der Hauptstadt wesentlich mitprägen“ sollte, nur noch bei neuen Verkehrserschließungen, so der Straßenbahnverlängerung aus dem Ostteil in den Westteil der Stadt. Eine andere: Abmagerung der CD-Gesamtkonzeption hinsichtlich des Materialeinsatzes. Im Detail heißt das beispielsweise, daß die neuen Informations-, Leit und Hintergleisbänder der U- Bahnhofsschilder nicht in Email ausgeführt oder wenigstens matt lackiert zum Einsatz kommen, sondern pulverbeschichtet mit aufgeplotteter Schrift aus Kunststoffolie. „Da ist rascher funktionaler und ästhetischer Verschleiß vorprogrammiert, und mutwillige Beschädigung wird leichtgemacht“, prognostiziert Erik Spiekermann, der den Berliner Stadt- und Verkehrspolitikern hier schlichtweg kurzsichtiges Kulturbanausentum vorwirft. Und Arcus-Vater Albrecht Ecke schäumt, wenn er heute an der Straßenbahnstelle, am miesen Plagiat seines Informationsträgersystems steht, mit dessen Installation fortan die pflichtgemäße Auszahlung von Royalities umgangen wird.
Wie in Berlin weht Planern und Gestaltern einer zeitgemäßen urbanen Umweltkultur sowie deren potentiellen Nutznießern, den Bürgern, fast allerorten in Deutschland ein Pandora-Hauch aus den Stadtkassen entgegen, der sich in schleichender Vernachlässigung bis hin zur Verwahrlosung kommunaler Stiefkinder, ganzer Stadtbezirke, aber beispielsweise auch abseits gelegener Kleinbahnhöfe niederschlägt: Während die großen Bahnhöfe in Deutschland derzeit nach den Plänen der Deutsche Bahn AG auf dem Wege sind, „moderne Stadttore“ zu werden, sieht die Gegenwart und Zukunft für Hunderte kleiner Haltepunkte und mittlerer Stationen des regionalen Schienenverkehrs namentlich in den neuen Bundesländern trist aus.
Gerade dort aber hat die Verkommenheit von Bausubstanz, Ausstattung und unmittelbarem Umfeld vielerorts längst einen katastrophalen Zustand erreicht: vergammelnde Provisorien von Anbauten, unbrauchbare Rudimente von Bahnsteigausrüstungen, Atemnot und Verfolgungswahn provozierende Fußgängerunterführungen, altehrwürdige Empfangsgebäude, die zu kommunalen Hinterhöfen und Sammelstellen sozialen Strandgutes wurden. Um das Elend zu lindern, werden hier nun Zug um Zug moderne Streuartikel aus dem DB-Ausstattungsdepot abgeladen: einheitliche neue Abfallaufnahmebehälter, Sitzgelegenheiten und Informationsaufsteller. Die Tristesse des sonstigen Stations-Umfeldes wird dadurch nur noch augenfälliger.
Ein Gestaltungs-Projekt „Ausstattungen des regionalen Schienenverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern“, 1996 vom Schweriner Landes-Designzentrum gestartet, wollte hier selbständige Aufbruchszeichen setzen. Auf Workshops mit in der Region ansässigen Designern und Architekten wurden Alternativ-Entwürfe mit landestypischen und zugleich modernen (nicht modischen) Architektur-, Formen-, Material- und Farbkonzepten erarbeitet und dabei auch darauf geachtet, „daß alle realistischen Varianten ausschließlich von regionalen Produzenten, Bauausführenden und Dienstleistern umgesetzt werden können“, so der Brandenburger Designer und Projektleiter Reinhard Otto Kranz. „Das würde Arbeitsplätze und Steueraufkommen im eigenen Lande schaffen, und wer hier an einem kleinen Stadtbahnhof oder ländlichen Haltepunkt aus dem Fenster schaut oder aus dem Zug steigt, soll sich auf den ersten Blick unverwechselbar in Mecklenburg und Vorpommern willkommen geheißen fühlen.“
Nach der sehr wohlwollenden Begutachtung der teilweise erstaunlich ausgereiften rund 50 konkreten Gestaltungsideen durch Vertreter der Deutsche Bahn AG aus Frankfurt am Main, Hamburg und Schwerin sowie des Schweriner Landes-Wirtschaftsministeriums sagten die Bahnplaner und Regionalpolitiker zu, noch 1997 gemeinsam mit den Designern ein erstes Pilotprojekt am Bahnhof Grevesmühlen starten zu wollen. Bis heute steht es jedoch auf totem Gleis – wie das Schweriner Designzentrum selbst, das seitens der Landesregierung ab 1998 keine institutionelle Haushaltförderung mehr erhält.
[/paycontent]
(1998 für ZEITpunkte; in alter Rechtschreibung belassen)