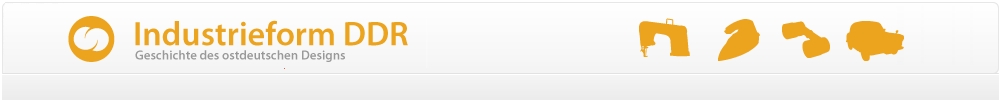Anmerkungen zum Verhältnis von Design, Politik und Welterfahrung in der DDR
(Ansprache zur Eröffnung der Dauerausstellung „Formgestaltung in der DDR“ im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR, Eisenhüttenstadt, am 15. Mai 2011)
Von Günter Höhne
Dresden im Jahr 1950. Die hier ansässige Hochschule für Bildende Künste verbreitet unter dem Titel „Das Beste für den Werktätigen“ ein großes Falt-Poster, auf dem sie für das Studium „Industrielle Formgebung“ wirbt. Initiator ist der hier wirkende Leiter dieses Studienbereichs, der niederländische Architekt und Sozialist Mart Stam, einstiger zeitweiliger Lehrer am Dessauer Bauhaus und Stahlrohrmöbel-Pionier der Zwanzigerjahre. Er erhofft sich von dieser jungen deutschen „Volksdemokratie“ DDR, seine 1933 begrabenen Visionen nun doch noch verwirklicht zu sehen: jene von einer menschenfreundlichen, erschwinglichen, ehrlichen und dauerhaft verlässlichen, kurzum sozial und nicht am Profit orientierten materiellen Alltagskultur für jedermann.
Im selben Jahr wird Stam nach Berlin-Weißensee gerufen worden, um dort die 1947 gegründete Hochschule für angewandte Kunst als Rektor zu leiten. Neben ihm arbeiten um diese Zeit im gleichen Sinne und mit demselben Enthusiasmus in Weimar der Gebrauchsgrafiker, Interieur-Gestalter und Hochschullehrer Horst Michel am Institut für Gestaltung der Hochschule für Architektur und Bauwesen, an der Hallenser Kunstschule Burg Giebichenstein dessen Kollege und Ex-Bauhäusler Walter Funkat und an der Arbeitsschule für Güte und Form in Wismar der Kunstschullehrer und Kulturfunktionär Werner Laux.[paycontent]
Stam aber soll alsbald eines der ersten Opfer stalinistischer Ostberliner Kulturpolitik sein. Die SED-Führung jagt ihn im Zuge der so genannten „Formalismusdebatte“ 1952 aus dem Amte, und er verlässt desillusioniert die DDR. Michel hingegen gelingt es noch, ausgelegten ideologischen Stolperdrähten auszuweichen. Bis jedoch auch ihn 1962 die Partei-Keule streift. Anlass ist die von ihm mitverantwortete Auswahl von angeblich „formalistischen“ Gebrauchsgegenständen für die Präsentation auf der V. Deutschen Kunstausstellung in Dresden. Die hier gezeigte Moderne junger DDR-Industrieformgestalter wird in einem Hetzartikel des SED-Zentralorgans Neues Deutschland unter der Schlagzeile „Hinter dem Leben zurück“ als „westlich dekadent“ und als „seelenloser kalter Formalismus“ gebrandmarkt. Michel hat sich indes bereits so viele Verdienste als Güte-Theoretiker und -Praktiker auf dem Gebiet des DDR-Industriedesigns erworben, dass aus dem Anschiss kein Rausschmiss mehr werden kann.
Sein Weimarer Institut haben 1951 die allerersten vier „Diplom-Formgestalter“ Ostdeutschlands verlassen, ihnen werden bis zum Zusammenbruch der DDR noch tausende Fach- und Hochschulabsolventen weiterer Ausbildungsstätten für Industrieprodukt-, Textil- und Mode-, Grafik-, Keramik-, Glas- und Holzgestalter folgen. Sie finden Aufträge und (unter mehr oder weniger sanftem staatlichen Druck auf die Werkleitungen) in zunehmender Anzahl auch Anstellung in den „volkseigenen“ Betrieben. Dort bemühen sich die meisten Designerinnen und Designer – oft im zähen Kampf gegen eine in den Führungsetagen und Konstruktionsbüros verbreitete kulturelle Ignoranz und Tonnen-Ideologie – das vom Reißbrett aufs Fließband zu transportieren, was ihre im Geiste des Bauhauses und anderer progressiver Gestaltungskonzepte Lehrenden ihnen zu gestalten aufgegeben hatten – jenes „Beste für den Werktätigen“.
Dabei schauen sie sich aufmerksam rechts und links um. Bis 1961 ist die DDR zum anderen Deutschland hin noch nicht hermetisch abgeriegelt, und gerade für die Ostberliner Studierenden der angewandten Kunst bietet eine einfache S-Bahnfahrt von Pankow nach Bahnhof Zoo täglich grenzenlose Möglichkeiten der Information, Anschauung und kritischen Auseinandersetzung in punkto aktueller Designtendenzen in den entwickelten Industrien des Kapitalismus. Es spricht für sich, wenn heute noch in den Bücherschränken gestandener und mittlerweile längst in die Jahre gekommener einstiger DDR-Industrieformgestalter Mitbringsel von diesen Ausflügen nach drüben zu entdecken sind, so wie beim jetzt 88jährigen Wolfgang Dyroff (einem jener ersten Weimarer Absolventen von 1951) die 1953 in Düsseldorf erschienene deutsche Erstausgabe der Raymond-Loewy-Designerbibel „Hässlichkeit verkauft sich schlecht“ oder beim unlängst leider verstorbenen Jürgen Peters (1958 Absolvent bei Rudi Högner an der Kunsthochschule Berlin) der erste Vierteljahresbericht der Hochschule für Gestaltung Ulm „ulm 1“ vom Oktober 1958 sowie eine Mappe mit Informations- und Einschreibungsunterlagen für jene berühmte HfG. „Das Interessante für mich damals war“, so Peters, „dass ich dann verwundert feststellen konnte: Wir in Berlin-Weißensee sind in manchem, die Ausbildungsmethodik und -praxis betreffend, weiter als die Ulmer, haben vier, fünf Jahre früher damit begonnen als die. Zum Beispiel was Industrie-Orientierung und Interdisziplinarität angeht.“
Erklärtes internationales Vorbild für die angehenden und die praktizierenden DDR-Industrieformgestalter der Fünfziger- und Sechzigerjahre ist besonders die skandinavische Designer-Elite. Alvar und Aino Aalto, Poul Henningsen, Arne Jacobsen, Tapio Wirkkala, Verner Panton, die Idee vom nordischen Funktionalismus und dessen „Demokratischem Design“ begeistern die ostdeutschen Produktgestalter. Für sie ist hier so etwas wie ein handhabbarer ideeller und materieller Ansatz für „sozialistisches Design“ zu finden.
Interessanterweise taucht jedoch nirgendwo in den publizierten designtheoretischen und designpolitischen Hinterlassenschaften der DDR eine Deklaration oder gar kritische Sichtung zu diesem immer wieder einmal geisterhaft umherschwirrenden, aber nicht zu fassenden Begriff „sozialistisches Design“ auf. Er beziehungsweise es existierte nicht, ausgenommen in ein paar um ihn mäßig bemühten marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaftlerhirnen, denen hierbei allerdings nichts Handfestes entrann. Weil sich eben „sozialistisches Design“ weder schlüssig theoretisch untermauern noch gar praktisch bewerkstelligen ließ. Man lebte, entwarf und konsumierte letztendlich doch in einer Marktbedingungen unterworfenen Warenwelt.
Aus gutem Grund heißt somit die erste umfassendere, 1971 veröffentlichte Schrift zum Designprozess in der DDR auch nicht „Sozialistische Produktgestaltung“, sondern „Produktgestaltung im Sozialismus“. Eine interessante, ehrliche Konsequenz. Verfasser ist Martin Kelm, und es ist dies die Veröffentlichung seiner Dissertation an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED.
Auch Kelm ist einstiger Högner-Absolvent an der Kunsthochschule Berlin, Kommilitone von Jürgen Peters, Horst Giese, Erich John, Clauss Dietel, Lutz Rudolph und weiteren Durchreißern im DDR-Design der späten Fünfziger und der Sechzigerjahre. Diese Namen werden Ihnen heute in dieser Ausstellung mehrfach als Urheber schöner und nützlicher Alltagsprodukte begegnen.
Heute wissen wir übrigens, dass es Martin Kelm als damaligem FDJ-Sekretär an der Hochschule zu verdanken ist, dass es hier überhaupt zur bleibenden Installierung des Studiengangs Industrielle Formgestaltung kommen konnte: Der erste Kurs sollte 1958 nämlich nach dem Willen der Hochschul-Parteileitung urplötzlich gar nicht mehr zur Diplom-Abschlussprüfung zugelassen werden. Man war der Meinung, das seien doch keine ordentlichen Kunststudenten, sondern – so wörtlich – „nur Produktkosmetiker“; die Industrie wisse doch auch ohne solche Spinner selbst am besten, was auf dem Markt ginge und was nicht.
Professor Rudi Högner war fassungslos, als ihm diese Entscheidung mitgeteilt wurde. Er selbst sah als Parteiloser keine Chance, sich dagegen aufzulehnen. So trat er deprimiert vor die Klasse und verkündete apathisch: „Ihr könnt Eure Sachen einpacken, es wird keine Diplomverteidigung geben.“ Da war es Kelm, der rief: „Das werden wir nicht zulassen!“ und agitierend Sturm lief beim Kulturministerium und durch alle Parteiinstanzen in Berlin und es schließlich erreichte, dass die Abschlussprüfung „probeweise“ in Anwesenheit von Vertretern der Industrie doch stattfand – unter der Voraussetzung, dass die Diplomarbeiten die Betriebsvertreter überzeugen würden. Das geschah auch: Alle Kandidaten schlossen mit „sehr gut“ ab, und die anwesenden Werkleiter waren begeistert von den Entwürfen und setzten sie samt und sonders in die Serienproduktion um. Kelms für den VEB Kranbau Eberswalde entworfene Portal-Hafenkran-Serie zum Beispiel beeindruckte dabei nicht nur als Hingucker, sondern brachte dem Hersteller zudem eine ökonomische Ersparnis von 30 Prozent und entriss dem anwesenden Chefkonstrukteur den spontanen Ausruf: „Da stellt sich ein Formgestalter-Absolvent hin und präsentiert uns eine Lösung, auf die meine eigenen Statiker nicht gekommen sind!“
Kelm selbst hat damit seinen Ruf als Macher weg im Kulturministerium und bei der Partei und wird sozusagen zum Feuerwehrmann beim Entwickeln und Durchsetzen von Designstrategien in der DDR. Er wird 1960 nach Halle geschickt, um dort an der Kunstschule Burg Giebichenstein ebenfalls die Ausbildung von Formgestaltern gegen so manchen Vorbehalt durchzusetzen, wird anschließend beauftragt, das staatliche Berliner Institut für angewandte Kunst zu leiten, aus dem dann das Zentralinstitut für Formgestaltung wird und schließlich 1972 das Amt für industrielle Formgestaltung beim Ministerrat der DDR und er selbst als Leiter Staatssekretär. 1979 wird Kelm in einem Festakt in Berlin die allererste von ihm zu vergebende Medaille „Designpreis der DDR“ seinem Ex-Lehrer Rudi Högner anheften.
Genau zehn Jahre später, Ende Oktober 1989, erfährt Staatssekretär Kelm, dessen Ehefrau Elli übrigens Erich Honeckers Büroleiterin ist, während eines offiziellen Japan-Aufenthaltes, dass die DDR und mit ihr alle hohen Amtsträger ihr Verfallsdatum erreicht haben, Honecker gestürzt ist und die Mehrzahl der mittlerweile 250 Mitarbeiter seines Amtes den Glasnost- und Perestroika-Aufstand probt.
Zu dieser Zeit ist es mit dem DDR-Design als „demokratischem“ und ganz dem „Werktätigen“ zugedachten nicht mehr weit her, trotz einer 1978 eingeführten und jeweils zu den Leipziger Messen überreichten staatlichen Gestaltungs-Auszeichnung „Gutes Design“ für Industrieprodukte. In den Siebziger- und Achtzigerjahren waren durch Partei und Regierung erneute, extrem tiefe Einschnitte in die ostdeutsche Wirtschaftsstruktur erfolgt. Noch rabiater als zuvor schon wurden Betriebe zu gigantischen „Kombinaten“ verschmolzen, letzte verbliebene potente private und „halbstaatliche“ Firmen zwangsverstaatlicht und viele traditionsreiche Produkte wie „Omega“-Staubsauger, „Komet“-Haushaltgeräte oder „Erika“-Schreibmaschinen ihrer Marken-Identität beraubt. Sie gehen gänzlich oder teilweise in Kombinats-Namen wie „robotron“ oder „FORON“ unter oder werden „Warenzeichenverbänden“ wie RFT oder AKA untergebuttert. Zugleich verschwindet per Dekret die Binnenwerbung für Konsumgüter aus dem Alltag. Nicht mehr „Das Beste für den Werktätigen“, sondern „Keine Bedürfnisse wecken“ lautet die Devise. Apropos: Höherer Devisenerlöse im Westexportgeschäft zuliebe werden immer häufiger nicht bloß heimische Marken- und Erzeuger-Signets von den Ausfuhr-Produkten getilgt, sondern sogar das „Made in GDR“ gleich noch dazu. So erfahren die westdeutschen Käufer von schicken „Bruhns“-Radios, -Fernsehern und -Plattenspielern nie, dass diese, ebenso wie so manche „Privileg“- und „Hanseatic“-Haushaltgeräte, in der DDR entworfen und produziert worden sind.
Die DDR-Bürger interessiert allerdings ein anderes Verschwinden mehr: jenes so mancher Produkte im Angebot des Binnenhandels – eben infolge zunehmender Exporte. Und man entsinnt sich melancholisch der vergleichsweise goldenen Sechzigerjahre, als es auch in der DDR einmal mit viel Schönem und Praktischem gefüllte Verkaufsauslagen und sogar Versandhauskataloge und so etwas wie eine Werbe- und Verpackungskultur gab, auch wenn es schon damals gleichzeitig immer wieder zu „Engpässen“ und „knappen Warendecken“ kam. Unbestritten war dies aber die Blütezeit eines von Produktkultur-Profis geschaffenen DDR-Designs, das sich um den Anschluss an die internationale Moderne bemühte und zugleich durchaus auch eigenständige attraktive Form- und Gebrauchslösungen im Investitionsgüter-, Fahrzeug- und Konsumgüterbereich hervorbrachte.
Ende der Achtzigerjahre sind es zumeist nur noch warenästhetische Belanglosigkeiten, mit denen sich der Durchschnitts-Werktätige in Kaufhalle und Warenhaus begnügen muss, gestalterisch oft mehr gewollt als gekonnt westlichem Allerweltsdurchschnitt nacheifernd. Wer als Werktätiger das Beste für seine ehrlich verdiente DDR-Mark sucht, findet es immerhin doch gelegentlich noch: im Exquisit- und Delikat-Handel, hier nur leider zu Schwindel erregenden Preisen. Oder auch im RFT-Fachhandel – dort das Stereo-Kassettenradio für zweitausenddreihundert Mark, also zwei komplette Facharbeiter-Monatsspitzengehälter.
Dann kommt im Sommer 1990 die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Und es gibt alles, was das Herz begehrt. Toll verpackt aus dem Westen und gleich zum Mitnehmen und so spottbillig. Man kauft nichts mehr „von hier“, auch wenn das hiesige Beste nun mit einemmal auch im Angebot ist. Selbst Schleuderpreise rufen hier nur noch ein Schulterzucken hervor, aber nicht die schöne neue West-Mark für „DDR-Zeugs“ aus dem Portemonnaie.
Nach dem Amt für industrielle Formgestaltung Ende 1990 wird bald auch die ostdeutsche Industrie abgewickelt. Erst recht, wenn sie so konkurrenzfähig ist wie das Wittenberger Nähmaschinenwerk, das modernste in Europa. Zu den ersten, die ihre im Kapitalismus angekommenen „Veritas“-Arbeitsplätze verlieren, zählen hier wie fast überall die Designer. Und nun lernen sie, die sie doch genervt so viele Parteilehrjahr-Kurse ertragen mussten, das Staunen über einen neuen, bürgerlichen dialektischen Materialismus: Jenen von Wirtschaftswachstum und Wegwerfkultur.[/paycontent]