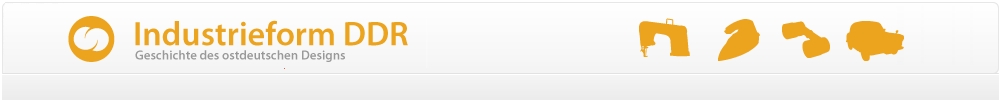Lieber Lutz Brandt, liebe Mitgäste und Freunde,
lassen Sie mich ein paar Betrachtungen anstellen vor allem zu Dingen und anderen Wirklichkeiten, die Sie heute hier in der famosen Oswald’schen Galerie nicht oder aber nur als skizzierte Zitate sehen werden.
Aus gegebenem Anlaß habe ich mich vorgestern an der Berliner Ecke Schönhauser Alle / Eberswalder Straße in die Straßenbahn gesetzt und bin vom Prenzlauer Berg ‘runtergefahren zum Frankfurter Tor. Wir wissen ja, daß es dort, am Beginn der Warschauer Straße, immer noch Lutz Brandts großes Giebel-Wandbild von 1980 gibt. – Herrgott, man ist da seither hundertemal vorbeigegangen und -gefahren. Aber genau angesehen hatte ich es schon lange nicht mehr. Und da habe ich nun verblüffende Entdeckungen gemacht:
Die auf Putz – oder korrekter wohl in Putz – gemalte „Reflexion“ (so heißt die in der Art einer heutzutage längst sogar in Billig-Videokameras integrierten „Rasterblenden-Technik“ gefertigte Widerspiegelungs-Illusion der anschließenden Plattenbau-Häuserfront), jene Reflexion also hat in all den Jahren überhaupt nichts von ihrer Struktur und kaum etwas von ihrer Farbigkeit eingebüßt! Ich habe zum Vergleich die Abbildung aus dem Katalog der IX. Kunstausstellung der DDR in Dresden von 1982/83 herangezogen – Gedanke und Ausführung heute so frisch wie eh und je. Das ist schon ein Wunder, zumal bei einem Bauwerk, das wie hier unmittelbar am Hauptverkehrsstrom gelegen ist. Wundersam aber ist auch ein weiteres Phänomen, auf das ich stieß:[paycontent]
Lutz Brandts ins Lichte, Sonnige verkehrte verrückt-auflösende Reflexion der vor 20 Jahren tiefdunklen Bürogebäudefassade hat sich nunmehr – und ganz ohne Zutun des Künstlers – zu einer noch irritierenderen Zerr-Widerspiegelung gewandelt: Die „real existierende“ Großplattenfront erhielt nämlich in letzter Zeit eben genau denselben Anstrich, den der imaginäre Widerschein des hervorspringenden Giebelbildes ihr immer ironisch entgegengehalten hatte.
Die modernisierte, nun helle Fassade spiegelt jetzt sozusagen die Widerspiegelung des Kunstwerks wider. – Das dürfte ein bisher einzigartiger Vorgang in den Annalen der Kunst-am-Bau-Geschichte sein.
Die Betrachtung von Lutz Brandts Giebelbild an der Warschauer Straße gibt mir übrigens gute Gelegenheit, in ein erstes Biographie-Detail des Meisters hineinzuleuchten:
Da sehen wir am linken Rand der „Reflexion“, daß sich die Plattenfront in einen bunten Holzbaustein-Turm aufgelöst hat. Mit dem hat es seine konkrete Bewandtnis: Als Lutz Brandt noch ein Vorschulknirps ist, bekommt er – es ist Krieg, Bombenkrieg in Berlin und längst Mangel an vielem – eine große Kiste solcher Kinderbauklötze geschenkt. Die hat sein Vater, ein Vollblut-Techniker, eigenhändig und nach allen Regeln der modularen Kunst aus Birnbaumholz geschnitten und poliert. Und der Junge baut und baut: Türme doppelt so hoch wie er selbst, und die Eltern sind immer wieder ganz aus dem Häuschen: Nee, dieser Junge! So schön und wackelfest sind diese Konstruktionen – der wird mal Baumeister!
„Baumeister“ – ein tolles Wort, das sich dem Knäblein regelrecht „ins Gehirn einbrennt“, wie er sagt. Und so wird er sich später, immerhin schon Maurer geworden, x-mal an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee um ein Architekturstudium bewerben und x-mal zurückgewiesen werden, aber dann eines Tages doch zugelassen. Da ist er dann zwischendurch allerdings auch mal drei Jahre aus der DDR „abgängig“ gewesen: ‘58 mit der S-Bahn „nach drüben“ und 1961, nach dem Mauerbau, der Liebe wegen (nicht unbedingt zur DDR) wieder „rüber“. – Aber das ist eine Geschichte für sich, wenn auch eine für ihn exemplarische. Ich komme darauf noch zu sprechen.
Zurück aber erst noch mal zum Giebelbild an der Warschauer Straße und zu den Bauklötzen: Es ist typisch für viele der künstlerischen Arbeiten Lutz Brandts, daß er in die gerahmten und ungerahmten „mobilen“ wie die für den öffentlichen Raum, für Immobilien und damit sozusagen für „den gesellschaftlichen Bedarf“ geschaffenen immer wieder ganz persönliche, ja private Mitteilungen, Verweise, Zitate einbringt. Aber weder gebärden die sich jemals sphinxhaft-intellektuell noch anbiederisch-populistisch. Lutz Brandt bringt hier weniger „poetische Lösungen“ ein, wie das Peter Guth sehr gut gemeint in seinem jüngsten (und sehr empfehlenswerten) Buch über baugebundene Kunst in der DDR sagt („Wände der Verheißung“ ist sein Titel) – vielmehr sind es poetische Verwicklungen, Durchflechtungen, Geheimnisse, mit „nur dem Auge“ kaum wahrnehmbare Rhizome (das sind Wurzelgeflechte, laut Duden „Erdsprossen mit Speicherfunktion“). Die machen diesen imaginären Mehrwert an Künstlerbotschaft bei Lutz Brandt aus – und die müssen, ja dürfen gar nicht an die Sonne, an den Tag gebracht werden.
Gerade das ist ja das Faszinierende, das ganz Eigene an seinen Bildern: Daß man sich oft fragt „ja ist denn das die Wirklichkeit – oder ist denn das die Möglichkeit??!“
Lutz Brandt nämlich ist in vielerlei Hinsicht ein „Wanderer zwischen den Welten“ – was zu DDR-Zeiten, und in denen hatte er seine ersten großen Erfolge, durchaus kein wohlmeinendes Etikett war. „Sag mir, wo Du stehst!“ hieß vielmehr die Parole.
Wanderer zwischen den Welten… Da waren also:
die Wanderungen zwischen Ost und West, hin und her und wieder zurück, endgültig 1984, als er im Auftrag des DDR-Kunsthandels als „Devisenbeschaffer“ offiziell öffentliche Kunst am Bau in Westberlin installieren darf. Wir restlichen Ostmillionen sind ihm dann 1990 allesamt gefolgt – von ihm kopfschüttelnd festgehalten (aufzuhalten war da nichts mehr), nur für einen Moment festgehalten also in dem ungeheuer vielschichtigen Gemälde hier linkerhand.
Da war:
Die Wanderung von der, in Berlin-Weißensee beim Bauhäusler Selman Selmanagic mit Diplom-Erfolg studierten, Architektur (mit einem dreijährigen Ausflug in die industrielle Formgestaltung) hin zur Wandmalerei, Kunst am Bau, Grafik, Studiomalerei, Bühnenbildnerei und Filmausstattung, die also keine Ab-Wanderung war, sondern für die Architektur eine segensreiche künstlerische Zuwanderung. (An die 30 Stecknadeln allein in Lutz Brandts Berlin-Plan künden von seinen temporären oder bleibenden Einmischungen hier.) – Warum hängt der Plan nicht hier?!
Da war und ist
dieser im doppelten Wortsinn „durchgängige“, also kontinuierliche und membranhafte Dualismus, dieses unablässige, bereitwillige Hin- und- Herkommunizierenkönnen (eine immer seltener werdende menschliche Gabe!) im Leben und im Werk des Künstlers:
diese inhaltliche und formale Verdichtung (Verdichtung heißt hier oftmals auch Weglassen, Aussparen von Umfeld, das Freistellen von Details) und Solidität der Brandt’schen Schaustücke (die oft zugleich historische Schau-Plätze repräsentieren) – und jene ungeheure, gewitzte Mobilität zugleich, mit der er auf Situationen und Ereignisse reagiert. Und auch die heitere Gelassenheit, Selbstverständlichkeit, mit der er sich voll bewußt auf die Mobilität in Richtung „Totalschaden“ einläßt, der viele seiner akribisch-liebevoll entstehenden öffentlichen Werke von vornherein ins Auge zu blicken haben: Der Dussmann-Bauzaun an der Berliner Friedrichstraße etwa, sozusagen mit hinten aufgedrucktem Verfallsdatum, aber eben auch Außenwandbilder:
Das einstige an der Giebelwand Ecke Leipziger und Breite Straße mit dem Kulturbauten-Orientierungsplan für Berlin-Mitte ist jetzt vom Anschluß-Rohbau des künftigen Hauptquartiers der deutschen Unternehmer- und Wirtschaftsdachverbände für immer zugedeckt. – Es sei denn, die Bauherren übernähmen die ursprüngliche Kunst am Bau nun gleich als Kunst im Hause. Aber wann kämen Wirtschaftskapitäne auf das Nächstliegende?
Lutz Brandt verfolgt zeit seines Schaffens aus seinem Ruderhaus über den vielzitierten Wogen der Geschichte beides: Im Flüchtigen, Hinfälligen, Untergehenden bleibenden Wert zu entdecken und sozusagen zu kartieren (siehe die Blätter und Bilder von der Baustelle Berlin Potsdamer Platz oder auch die doppelsinnig so von ihm bezeichneten „Wandbilder“- Quasi-Originale hier linkerhand) und aus dem Monumentalen, auf Ewigkeit Gebauten die Vergänglichkeit herauszuhören wie die Glocken von Atlantis.
Dabei ist sein nicht nur individuelles Einbringen (das ja vom Künstler per se zu erwarten ist), sondern intimes Äußern weit enfernt von jeglicher Eitelkeit („Seht, was für ein Schlitzohr ich bin!“). Ob in geheimen Andeutungen und sehr persönlichen Danksagungen (wie jener an seinen Vater im Wandbild an der Warschauer Straße) oder (auf dem Brandenburger-Tor-Bild) so total offen gegen den Strom – Lutz Brandt gibt immer sich und gibt nie mit sich an. Das unterscheidet ihn ganz wesentlich von den Manieristen, zu denen ihn der eine oder andere Kunstkritiker leichtfertig gesellen mag.
Geben Sie sich nun der Ausstellung hin, deren Zustandekommen übrigens unserem unglaubwürdig Sechzigjährigen erst von seinen Freunden eingeredet werden mußte und an deren aller Statt ich Friedrich Nostitz nennen möchte, für den als Laudator einzuspringen ich heute „umständehalber“, wie man so sagt, die große, überraschende Ehre hatte.
[/paycontent]
(Laudatio „Lutz Brandt“ / Galerie Am Neuen Palais Potsdam, 6. Sept. 1998)